Kategorie: Zeitschriftenarchiv
Minuszinsen – Wer gewinnt, wer verliert? – Andreas Bangemann
Mythos vom „Kleinen Sparer“ – Warum niedrige Zinsen für viele Geldanleger von Vorteil sind. – Zusammenfassung: Für Geldanlagen bekommt man welche – für Kredite muss man sie bezahlen: Zinsen. Oft wird jedoch übersehen, dass man auch Zinsen bezahlt, wenn man überhaupt keine Schulden hat. Zinsen stecken nämlich in allen Preisen und…
Zu den Waffen greifen – Offener Brief von Jürgen Todenhöfer
Der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck überraschte im Januar 2014 vieler seiner Landsleute, als er zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz dafür plädierte, Deutschland müsse sich – auch militärisch – stärker für Sicherheit und Menschenrechte einsetzen. Das führte zu kontroversen Diskussionen darüber, ob wir uns auf Kriege vorbereiten müssten, die nicht mehr…
Der mühsame Weg… – Pat Christ
Noch gibt es keinen „MittelFranken“. Über Umwege wirbt der Verein Regio-Mark für eine Komplementärwährung. er nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, wird es kaum schaffen, zeitlebens einen solchen zu bekommen. Denn Geld fließt gewöhnlich zu denen, die Geld haben. Es sei denn, es handelt sich tatsächlich um…
Der eine kann dies… – Bericht von Andreas Bangemann
„Wirkgeld statt Würggeld“ – Der „Regionalgeld Schleswig Holstein e.V.“ feierte das 10-jährige Jubiläum seines „KannWas“ Dr. Frank Schepke, Bio-Landwirt und ehemaliger Olympia-Goldmedaillengewinner im Rudern, war 2004 Initiator und Mitbegründer des Vereines, der bis heute die Regionalwährung für Schleswig Holstein trägt. Angetreten, um sich für ein besseres Geldsystem einzusetzen, bewies das…
12 Stunden Goldener Schlaf – Claudia Pflug
Lieber Herr Bangemann, wir hatten Ende letzten Jahres miteinander telefoniert, da ich Ihnen meine neue Anschrift mitgeteilt hatte. Außerdem war mein kleines Baby unterwegs. Teresa Marie Mildred ist inzwischen schon über drei Monate alt. Im Hinblick auf die Ziele Ihrer Zeitschrift – die Kritik des Kapitalismus, oder besser, die Überwindung…
Die „Schöne aus Marienhöhe“ darf nicht sterben – Pat Christ
Saatgutaktivisten kämpfen gegen die geplante Novellierung einer EU-Verordnung – Radieschen, Mohn und Zitronenbasilikum, Obsidian, Slim Jim und Wilde Rauke: Dutzende Raritäten und bewährte Hausgartensorten gab es im Februar beim Saatgut-Festival im unterfränkischen Iphofen zu bestaunen und zu erwerben. Stargast der Veranstaltung, die mehrere hundert Besucher von teilweise weither anzog, war…
Schon wieder – Laura Gottesdiener
Die Preise für Eigenheime steigen! Die Baukonjunktur springt wieder an! Die Krise ist überwunden! Seit einiger Zeit bejubeln die Medien in den USA die wundersame Wiederauferstehung der Immobilienmärkte. Was sich hinter dem ganzen Tamtam verbirgt, erfährt man nicht. In der Branche breitet sich seit knapp zwei Jahren eine komplett neue…
Der Strudel in die Sucht – Karl-Dieter Bodack
• Steuern werden als „Last“ bezeichnet, als „Belastung“ empfunden, von der man sich „befreien“ sollte;
• „Steuerersparnis“ wird hoch geschätzt, erhält gesellschaftlichen Wert, es gründen sich Unternehmen, die Steuer„ersparnis“ als Dienstleistung anbieten und dafür gute Honorare verlangen;
• In Gesprächen lobt sich jeder, der es geschafft hat, Steuern zu „sparen“, andere erkundigen sich, es entsteht eine Art neuer Volkssport des „Steuersparens“, mit einem gesellschaftlichen
Wert wie er seinerzeit dem Sparbuchsparen zukam;
• Von den Politikern wird gefordert, dass sie alles Wünschenswerte schaffen, Theater, Schulen und Kindergärten, Hilfe für Familien, die Volkshochschule, Umgehungsstraßen, Bürgerparks, Kinderspielplätze, mehr Busverbindungen schnellere Zugverbindungen;
• Politiker werden geschätzt, die das schaffen, Steuern zu senken und gleichzeitig möglichst alle Wünsche erfüllen;
• Die Folgekosten werden ignoriert: Was der Spielplatz monatlich in der Pflege, das Theaterensemble pro Zuschauer, der Park pro Spaziergang kostet, ist tabu, niemand spricht darüber,
keiner will es wissen;
• Bürger sparen als Vorsorge für schlechtere Zeiten oder fürs Alter, bringen Geldbeträge zu Banken, verlangen möglichst hohe Zinsen dafür;
• Die Kommunen, Länder und der Bund brauchen viel mehr Geld als sie einnehmen, leihen es von den Banken, richtiger von den Bürgern mit dem Versprechen („Bundesschätze“), es zurückzuzahlen;
• Berühmt wird ein Politiker nicht mit einem Park für ein paar Millionen, sondern erst mit einem „Freizeitpark, der ein paar hundert Millionen kostet;
• Anfängliche Millionen-Anleihen werden zu Milliarden-Anleihen;
• Politiker werden gefeiert, wenn Sie als „Überväter“ wissen, was den Bürgern guttut und wenn sie das auch gegen Widerstände all derer, die mangels Einsicht dagegen sind, durchdrücken;
• Die Zinsen für die Kredite beanspruchen mehr und mehr Anteile aus den Steuergeldern;
• Die Kreditsummen steigen, weil mehr und mehr Steuergelder von Zinszahlungen absorbiert und gleichzeitig die Projekte immer größer werden;
Das transatlantische Freihandelsabkommen – Wolfgang Berger
Finanzielle Massenvernichtungswaffen fahren die Ernte ein -
»Le Monde diplomatique – die französische
Zeitung für auswärtige Beziehungen
– bezeichnet das transatlantische
Feihandelsabkommen TAFTA
(Transatlantic Free Trade and Investment
Agreement) als „Staatsstreich in Zeitlupe“.
In geheimen Verhandlungen wird
es von den mächtigsten Konzernen der
Welt, die von 600 Industrieverbänden
vertreten werden, vorbereitet. Gesetze
benachteiligen immer diejenigen, die
bei ihrer Verfassung nicht dabei sind.
Dabei wird der Mensch „wie ein
Konsumgut betrachtet, das man
gebrauchen und dann wegwerfen
kann“, schreibt Papst Franziskus
im Evangelii Gaudium und fügt hinzu:
„Diese Wirtschaft tötet“. Sie tötet die
Würde, die Freiheit und den Sinn des
Lebens der meisten Menschen.
Vielleicht hat Benito Mussolini den
Begriff Faschismus passend definiert:
„Die Fusion zwischen Großkonzernen
und Staaten“. Wie ist dieser
Vernichtungsfeldzug geplant worden?
Wie wird er durchgeführt?
Das Killer-Spiel
„Live and let die“
(Lebe und lass andere sterben)
Banken vergeben Kredite gegen Sicherheiten.
Jeder Firmenchef und jeder
Hauseigentümer weiß das. Bei
der Kreditprüfung wird meist ein
Fünftel Eigenkapital verlangt. Für die
Banken selbst gilt diese Regel nicht.
Große Banken arbeiten mit 95 Prozent
Fremdkapital und hebeln so den
Ertrag auf ihr eigenes Kapital. Eine
Million Gewinn bleiben eine Million,
wenn das Geschäft mit Eigenkapital
finanziert wird. Bei fünf Prozent Eigenkapital
erhöht sich der auf das
Eigenkapital bezogene Gewinn dann
fast um das zwanzigfache.
Damit rechtfertigen die Banken die Millionengagen
Ihrer Topmanager, die diese
Gewinne „erwirtschaften“ – oder
sollen wir besser „ergaunern“ sagen?
Die Versuchung ist groß, dabei Risiken
einzugehen, die die Bank selbst nicht
auffangen kann. Gilt die Bank als systemrelevant
weil sie „too big to fail“ (zu
groß zum Scheitern) ist, werden ihre Verluste
auf die Steuerzahler abgewälzt.
So sind die Staatsschulden explodiert
und ganze Länder in den Bankrott getrieben
worden. In der Krise waren die
Staaten dann „too week to act“ (zu
schwach zum Handeln).
Der ersten Testläufe für dieses Spiel
sind vor zehn Jahren vorbereitet worden:
Niedrige Hypothekenzinsen und
die Erwartung steigender Immobilienpreise
haben auch Subprime-Kreditnehmer
(das sind solche mit schlechter Bonität)
in den USA zu Hauseigentümern
gemacht. Diese Kredite wurden zu „Derivaten“
(abgeleiteten Wertpapieren)
gebündelt und mit kurzfristigen Rückkaufvereinbarungen
(„Repos“: Sale and
Repurchase Agreements) weiterverkauft.
Hank Paulson – von 1999 bis 2006 CEO
(Vorstandsvorsitzender) der Investmentbank
Goldman Sachs – hat die
US-Banken Bear Sterns und Lehman
Brothers in Derivatgeschäfte in Milliardenhöhe
eingebunden. 2006 ist Paulson
US-Finanzminister geworden. Danach
haben neue Gesetze „Derivate“
in „safe havens“ (sichere Häfen) verwandelt.
Das bedeutet: Eine Bank, die Wertpapiere
über Derivate besitzt, kann sie
beim Konkurs der Schuldnerbank behalten.
2008 konnten Bear Sterns und
Lehman Brothers ihre Verpflichtungen
zum Rückkauf der „Derivate“ gegenüber
Goldman Sachs und dem britischen Finanzunternehmen
Barclays nicht erfüllen;
sie brachen zusammen. Die beiden
siegreichen Banken hatten zwei Konkurrentinnen
„gefressen“.
Durch EU-Direktiven haben die Besitzer
von Derivaten auch in Europa bevorzugten
Gläubigerstatus. Während
es im regulären Insolvenzrecht eine
Bevorzugung von Gläubigern nicht
gibt, ist sie bei Derivaten jetzt die
Norm. Derivate in Verbindung mit Repo-
Geschäften schöpfen Geld ohne Sicherheiten.
Die eine Bank nimmt, die
andere gibt – und das im Kreislauf ad
infinitum. Dieses Killer-Spiel wird in
den USA „Live and let die“ (Lebe und
lass andere sterben) genannt.
Der Bürger und sein Staat – Gerhardus Lang
Gedanken zur „Besteuerung“ – Jeder Selbstständige beschäftigt für
teures Geld einen „Steuerberater“.
Was berät denn der? Doch nur, wie
man zu viel Steuern vermeidet. „Steuervermeidung“
ist der Sinn seines Daseins,
sonst nichts. Jeder macht das
so und befindet sich damit im gesetzlichen
Rahmen. Im Übrigen ist das
Steuerrecht noch im Stadium wie zu
Zeiten von Christi Geburt, dessen Eltern
zum Zwecke der Steuerschätzung
nach Bethlehem reisen mussten, um
der Obrigkeit, der wir „untertan sind
und die Gewalt über uns hat“, den
geschuldeten Obolus zu entrichten.
(Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die
Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit
ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist,
die ist von Gott verordnet, Römer 13,1)
Heute ist die Obrigkeit von den
Parteien ausgewählt immer noch
eine Obrigkeit, die Gewalt über
uns hat und die beschließt, was wir ihr
schulden. Diese als Finanzbehörde fungierende
Einrichtung ist ein Staat im
Staate, die in dieser Form schon Jahrhunderte
besteht. Sie hat schon zu Zeiten
der deutschen Kleinstaaten existiert,
hat sich mit dem ersten deutschen
Reich gefestigt, hat den ersten und den
zweiten Weltkrieg ohne Abstriche überstanden,
hat dem Kaiserreich das Heer
und die Flotte finanziert, hat die Weimarer
Republik mit Inflation und Deflation
überstanden. Dann hat sie ungebrochen
dem Diktator Hitler seine Großmachtspläne
finanziert und durfte danach die
Staatspleite „abwickeln“.
Nehmen und Geben
Wir, das Volk, von dem alle Staatsgewalt
ausgehen sollte, müssen nämlich
langsam anfangen, tatsächlich selber
zu beschließen, was wir für die Zwecke
des Staates ausgeben wollen. Aber das
wird uns verweigert, weil wir so etwas
angeblich nicht beurteilen könnten.
Gerade auf dem Gebiet des Steuerrechts
wissen die Mächtigen genau,
wie sie vorgehen müssen, denn die
Kuh, die man melkt, soll vom Gemolken-
Werden möglichst nichts merken,
es soll diskret zugehen (Grundsatz der
Unmerklichkeit der Besteuerung). Es
ist dieses das Prinzip der Spitzbuben,
dass die Leute, die bestohlen werden,
es nicht immer gleich merken, damit
nämlich der Dieb möglichst unerkannt
bleibt. Man hat es dem Gott der Diebe
– Merkur – abgelauscht: man soll
möglichst überhaupt nichts merken.
Das haben auch die Kaufleute und –
last, but not least – die Ärzte (deren
Gott auch Merkur ist!) an sich, unmerklich
das wegzuschaffen, was zu viel ist,
dorthin, wo es fehlt, wobei sich die drei
Berufe im real existierenden Leben gelegentlich
schlecht voneinander unterscheiden
lassen, weil sie manchmal im
Einzelnen als Gemengelage auftreten.
Inwieweit nun Politiker – insbesondere
Steuerpolitiker – einer der drei genannten
Kategorien angehören, ist so
leicht nicht auszumachen. Sie müssen
auch einerseits wegnehmen, damit sie
woanders hinzufügen können. Sie können
dabei ärztlich handeln, wenn sie
beabsichtigen, den kranken Zustand
in einen gesunden zu verwandeln und
wenn die ergriffenen Maßnahmen auch
zu diesem hehren Ziel führen. Vorgeben
tun es die Politiker meist lauthals, dass
genau dieses und nichts anderes ihre
Absicht sei. Rechnet man es dann allerdings
vor – oder auch nach –, so landet
zum Schluss das Weggenommene häufig
dort, wo sowieso schon zu viel ist,
und wird genau denen letztlich weggenommen,
denen es gut getan hätte.
Dabei sind die Wege der zu verteilenden
Beute oft so verschlungen, dass
die Spuren in die Irre führen, was auch
der Gott Merkur bald nach seiner Geburt
meisterlich beherrschte, indem er
die seinem Bruder Apollo gestohlenen
Rinder rückwärts in sein Versteck führte,
damit es so aussähe, als wären sie in
entgegen gesetzter Richtung gelaufen
Ja, die Frage ist berechtigt: lässt sich
das Ruder „herumwerfen“, oder auch:
lässt sich das oder die Steuer herumwerfen?
Wenn die See stürmisch ist,
ist das nicht so einfach, und manch
ein Schiff ist gekentert, weil das Steuer
zu schnell oder auch zu spät herumgeworfen
wurde. Deshalb ist es sicher
gut, wenn nicht zu schnell herumgeworfen
wird, wobei dann vor allem der
neue Kurs stimmen muss: es wird zwar
dauernd der Kurs gewechselt, aber wo
es letztlich hingehen soll, welches Ziel
erreicht werden muss, darüber macht
sich kaum einer Gedanken. Hauptsache
das Schiff fährt mal wieder in einer
anderen Richtung, egal wohin die Passagiere
eigentlich wollen.
Im Mittelpunkt aller steuerrechtlichen
Überlegungen steht heute der Mensch
nur im Hinblick auf den Widerstand,
den er der „legalen“ Enteignung entgegenbringen
wird, aber nicht, wozu das
Ganze eigentlich dienen soll. Die zentrale
Frage: „Was ist der Mensch?“ wird
ausgeklammert. Die einzige Antwort
darauf lautet heute: Der Mensch ist ein
(böser) Egoist, und deshalb muss man
ihn zum Wohltun führen, z. B. durch
Erheben von Steuern für das Gemeinwohl,
da dieses nicht egoistisch, sondern
altruistisch (gut) sei. So wird der
Mensch auch gegen seinen Willen anscheinend
von einem bösen zu einem
(jedenfalls teilweise) guten Menschen
gemacht, was vom Gesichtswinkel der
Ewigkeit her ihm wiederum nützt (jedenfalls
im höheren Sinn). Wozu sich
also noch Gedanken machen!
Fehlt den Menschen das Bewusstwerden? – Richard Steinhauser
Gedanken zu Charles Eisenstein: „Die schönere Welt, von deren Möglichkeit unsere Herzen schon wissen“ -
Der Vision einer
schöneren Welt von
Charles Eisenstein
stimme ich vollauf zu –
sie ist möglich!
Muss man sich aber nicht zuvor
fragen: Warum ist die
heutige Welt nicht so schön?
Alles hat eine Ursache.
Was muss mir bewusst werden? Ich
lebe. Ich bin einer von sieben Milliarden
Menschen. Ich bin ein historisches,
soziales und personales
Wesen. Ich trage Verantwortung gegenüber
der Geschichte, der Gesellschaft
und mir selbst. Der religiöse
Mensch sieht sich als transzendentales
Wesen in der Verantwortung vor
Gott. Daraus folgere ich meine Lebensaufgabe:
Ich habe mein Leben auf der
Erde so zu gestalten, dass noch weitere
Generationen auf ihr Leben können.
Ist mir das bewusst?
Als geschichtliches Wesen schlummern
in mir Generationen. Als sozialem
Wesen erfahre ich, dass ich nur
durch das Du zum Ich werde. Eltern
haben mich gezeugt. Ich war hilflos
und vollkommen auf sie angewiesen.
Als Erwachsener habe ich Bedürfnisse,
die nur durch eine große Gesellschaft
erfüllt werden können. Als personalem
Wesen stehe ich vor allem in
der Verantwortung für meine Gesundheit.
Nur als gesunder Mensch kann
ich der Geschichte, der Gesellschaft
und mir selbst am besten dienen. Und
als transzendentales Wesen? Als denkender
Mensch versuche ich meinem
Leben einen Sinn zu geben. Ist mir das
bewusst?
Ich bin hineingeboren in die eine
Welt, in ein Volk, in eine Religion
(Konfession), in eine Gemeinde,
in eine Familie. Ich lebe in einem
Staat, der Gesetze erlässt und dadurch
weitgehend mein Leben bestimmt.
Ich benötige täglich Geld.
Das Geldwesen wird von der Ideologie
des Kapitalismus bestimmt. Der
Staat befindet über Krieg und Frieden.
Dies wird von der Ideologie des
Militarismus bestimmt. So leben wir
heute in der Welt des real und global
existierenden Militarismus. Der
Militarismus ist ein Gewaltsystem
und der Kapitalismus ein Schmarotzersystem.
Die ganze Welt steckt im
Teufelskreis der Gewalt und Ungerechtigkeit.
Diese Ideologien sind
die Verursacher unseres weltweiten
Dilemmas. Ist mir das bewusst?
Um leben zu können, braucht der
Mensch keinen anderen Menschen zu
töten, nicht einmal ein Tier. Was tut
der Mensch? Er führt Kriege. Es gibt
keine Rechtfertigung für den Militarismus.
Um leben zu können, braucht
der Mensch kein Millionär zu sein.
Was tut der Mensch? Er erfindet ein
Geldsystem, in dem man Multimillionär,
ja sogar Multimilliardär werden
kann. Es gibt keine Rechtfertigung für
den Kapitalismus. Militarismus und
Kapitalismus sind Lebenslügen. Sie
sind das institutionalisierte Böse in
der Welt. Ist mir das bewusst?
„Die Probleme, die es in dieser Welt
gibt, können nicht mit den gleichen
Denkweisen gelöst werden, die sie
erzeugt haben.“ (Albert Einstein). Zu
welcher Denkweise müssen wir gelangen?
Zur Gewalt (der Krieg ist die
schlimmste) gibt es nur eine Alternative,
die Gewaltfreiheit. Mit der Gewalt
kann kein Kompromiss geschlossen
werden. Die Gewaltfreiheit ist
eine fundamentale Wahrheit. Erst in
ihr sind wir unserer Menschenwürde
würdig. Die Gewaltfreiheit ist die Voraussetzung
für all unser Denken und
Tun. Nur so können wir unsere Probleme
und Konflikte, die es in jedem Zusammenleben
gibt, gewaltfrei durch
den Dialog lösen. Erst dann verhalten
wir uns wie vernunftbegabte Wesen,
sind wir Menschen.
Wie militärisches Denken hat auch
kapitalistisches Denken eine lange
Geschichte. Wie ein Trauma lasten
Militarismus und Kapitalismus auf
der Menschheit.
Die Teufelei geht weiter! – Kommentar von Wilhelm Schmülling
Mit welcher Arroganz zelebrierten bisher
private Banken eine Aura der Seriosität
– bis hin zur Inneneinrichtung
(Interieur genannt) und bis hin zum Nadelstreifenanzug
der Angestellten. All
das sollte die eigene Geschäftstüchtigkeit
unterstreichen und die Wertschätzung
gegenüber Kunden, die man großzügig
am Erfolg des Hauses teilnehmen
lassen wollte, Bonität vorausgesetzt.
Einige Privatbanken sortierten gleich
bei der Geschäftsanbahnung die „Minderbemittelten“
unter einem siebenstelligen
Vermögen aus. Denen war offensichtlich
nicht zu helfen, den gnädig
aufgenommenen Kunden der Upperclass
schon, auch zum Vorteil der Bank.
Dieses anmaßende Verhalten,
Image-Pflege genannt, setzte
sich mehr oder weniger bei allen
Banken durch – mit Ausnahme bei Sparkassen
und Genossenschaftsbanken.
Und so verbreitete sich unter den Kunden
ein nahezu grenzenloses Vertrauen.
Seit der Finanzkrise von 2008 zerbröselte
dieses Bild. Das Geld der Anleger wanderte
in zunehmendem Maße – auch
bedingt durch das schwieriger werdende
Kreditgeschäft mit der Realwirtschaft
– an den internationalen Finanzmarkt.
Mit der Verbriefung von Hypotheken
wurden zuerst Hausbesitzer in bittere
Not gestürzt, dann ganze Länder. Das
Geschäftsgebaren bewusster Übervorteilung
von Kreditnehmern wurde ruchbar.
Einmal demaskiert, versprachen die
Banken Besserung. Und alle Welt glaubte
ihnen. Denn eine solch offensichtlich
schädliche Geschäftsidee könne keinen
Bestand haben. Weit gefehlt, es muss ja
nicht die gleiche Masche sein.
Wer am 1. 4. 2014 auf ARTE um 23.20
Uhr die Dokumentation „Die Geschichte
der französischen Banken. Eine Tragikomödie“
angesehen hat, ist erschüttert
über die Rigorosität der Bankgründer
und dem Ziel, Profitmaximierung des
angelegten Kapitals nahezu risikolos
zu erreichen. Die Kapitalkonzentration
bei den Banken ermöglichte eine Reichtumssteigerung
neben dem Großgrundbesitz
nun beim Geldadel. Es war die
Gründung des modernen Kapitalismus
bis hin zum Raubtierkapitalismus. Alles
bei ARTE gut recherchiert. Wer sucht,
der findet. Allerdings zu nachtschlafender
Zeit. Wer Printmedien bevorzugt,
findet umfangreiche Berichte in alternativen
Zeitschriften, wie der HUMANEN
WIRTSCHAFT. Auch die hier vorliegende
Ausgabe ist dafür ein Beleg.
Jeder Beitrag wäre eines umfangreichen
Kommentars würdig. Wenn ich nun das
„Neue Geschäftsmodell mit US-Immobilien“
von Laura Gottesdiener herausgreife,
dann deshalb, weil darin exemplarisch
„schon wieder“ das kaltblütige
Geschäftsgebaren – diesmal mit Mietern
– beschrieben wird. Aus den Desastern
des Banken-Crash von 2008
haben jedenfalls die Hedgefonds nichts
gelernt. Schon 2009 titelte SPIEGEL
ONLINE „Hedgefonds starten wieder
durch“.
Was aber Laura Gottesdiener auf Seite
18 dieser Ausgabe enthüllt, ist die Spitze
der Teufelei, nämlich die Abzocke der
„Underclass“, vornehmlich der schwarzen
Bevölkerung. Sie wähnte sich am
Ziel Ihrer Träume, eine dauerhafte Bleibe
in einer Mietwohnung zu finden. Stattdessen
zerrannen viele Träume. Ohne
die Strategie der Reichtumsvermehrung
der Banken zu kennen, glaubten sie sich
dank der vorgelegten Verträge in Sicherheit.
Bis sie die Tricks der Banken und
ihrer Hausverwaltungen zu spüren bekamen.
Ergo: Statt Hausbesitzer sind
nun Mieter das Ziel der Abzocker.
Die Teufeleien gehen aber nicht nur mit
Häusern und Wohnungen weiter. Sie
erfassen auch die Welt-Handelsbeziehungen.
Nur Wenige wissen um das geplante
Freihandels- und Investitionsabkommen
(TTIP) zwischen der EU und den
Vereinigten Staaten von Nordamerika.
Kein Wunder. Denn die Verhandlungen
wurden geheim geführt. Wohlgemerkt
sind die Vertragspartner insgesamt
Demokratien. Wenngleich nach dem
öffentlichen Druck die Intransparenz
gelockert wurde, so bleiben konkrete
Verhandlungstexte unveröffentlicht.
Was so begrüßenswert als Freihandelszone
geplant wurde, entpuppt sich als
ein Versuch, eine Schutzzone vornehmlich
für Kapitalinvestoren und Konzerne
einzurichten. In diesem Heft und schon
in Heft 01/2014 haben unsere Autoren
die infamen Machenschaften erläutert.
Was schließen wir daraus? Nur in einer
freiheitlichen Ordnung, nicht aber in einer
ausschließlich auf Kapitalertrag fixierten
Wirtschaftsordnung sind grundlegende
Reformen möglich.
Die größere humanitäre Geste – Johannes Korten, Interview mit Ilija Trojanow
Johannes Korten führte das Interview mit Ilija Trojanow -
Ende Dezember 2013 hat GLS Online-Redakteur Johannes
Korten in Stuttgart den Schriftsteller und Autor Ilija Trojanow
getroffen. Im Gespräch ging es um die Datensammelwut von
Staaten und Unternehmen, fehlendes Bürgerengagement,
innere Widersprüche und die Arbeit als Schriftsteller. Ilija
Trojanow ist Kunde und Mitglied der GLS Bank.
»Mit Gewalt kann der Mensch nehmen,
aber nicht geben.« (Ilija Trojanow)
„Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
und die Verhinderung anlassloser Generalüberwachung
sind zentrale Themen, für die Sie sich immer
wieder und mit großem Engagement einsetzen.
Was treibt Sie dabei ganz persönlich an?“
„Die Frage ist eher, wieso spüre ich diesen Zugriff
und andere nicht? Die Motivation ist ja meistens
wirklich so ein Bauchgefühl, so eine Unerträglichkeit.
Stellen Sie sich vor, jemand guckt Ihnen über
die Schulter und schaut, was Sie gerade in Ihr Handy oder in
Ihren Computer tippen. Da kann und wird wahrscheinlich jeder
von uns mit Ablehnung reagieren oder mit Abwehr. Wie
kann es aber sein, dass Menschen es nicht als Übergriff, als
Repression, als Verachtung ihrer Würde empfinden, dass
Staaten und Großkonzerne sie in dieser Art überwachen, kontrollieren
und ihre Daten nach Belieben verwenden. Ich persönlich
empfinde das als nicht erträglich und kann mir auch
eine Gesellschaft, die halbwegs human ist und so etwas akzeptiert,
nicht vorstellen.“
„Was glauben Sie, worin diese Lethargie, diese
Gleichgültigkeit begründet ist? Warum bleibt dieser
Aufschrei, warum bleibt diese Wehrhaftigkeit in
weiten Teilen der Gesellschaft aus?“
„Ich glaube, es gibt ein grundlegendes Problem.
Wir bilden uns ein, wir seien demokratisch verfasst.
Dabei unterliegt – so glaube ich – unsere Ausbildung
und unsere Konditionierung weiterhin einer
uralten Logik, die alles andere als demokratisch ist, sondern
hierarchisch, eher gehorsam folgend als selbstbestimmt denkend
und agierend. Von den Menschen wird eher ein Mitschwimmen,
ein Mitlaufen, ein Kuschen verlangt, als dass
das demokratische Ideal eines selbstbestimmten Individuums
verwirklicht wäre, das sich Gedanken macht, hinterfragt,
kritisch agiert, sich engagiert und immer wieder diese Freiheit
für sich selber und seine Zeit erkämpft, verteidigt und erweitert.
Zumal Widerstand ja auch anstrengend ist und von
einem selbst ausgehen muss. In unserer Gesellschaft herrscht
ja das Prinzip der Fremdversorgung. Dissens wird aber nicht
bereitgestellt. Das muss man sich selbst erarbeiten.
Die meisten Leute haben das Gefühl, irgendwie wäre
ihnen eine vage formulierte Freiheit gewährleistet. Manche
setzen diese Zuversicht mit unserem Grundgesetz und den
darin verbrieften Bürgerrechten in Beziehung. Aber viele erliegen
dem Irrtum, diese Freiheit sei so stabil wie die Mauern
ihres Hauses. Das ist ein großes Missverständnis. Ich
glaube nicht, dass dieses System tatsächlich ein Interesse
daran hat, den von mir erwünschten freien und freiheitlich
denkenden kritischen Menschen zu erzeugen. Im Gegenteil,
wenn man sich anschaut, was in den letzten zehn Jahren
passiert ist, Stichwort Bildungsreform, geht es ja genau
in die entgegengesetzte Richtung: Freiräume verengen und
noch mehr zuspitzen auf ganz bestimmte, meist wirtschaftlich
relevante Tätigkeiten.“
„Das klingt ja wenig optimistisch. Wo sehen Sie
denn Chancen, dieses Verhalten aufzubrechen, die
Menschen dahin zu bewegen, die richtigen Fragen
zu stellen und quasi eine Systemveränderung in Ihrem
Sinne herbeizuführen?“
„Es ist ein Missverständnis zu glauben, dass die genaue
Analyse der herrschenden Verhältnisse eine
pessimistische Haltung zum Ausdruck bringt. Im
Gegenteil, genau das gibt uns Ermutigung. Wir können
keinen Mut fassen und wir können eine andere, bessere
Welt überhaupt nicht imaginieren, geschweige denn ihr entgegengehen,
wenn wir nicht ein klares Verständnis davon haben,
was uns im Moment einengt, was uns bindet, uns in unseren
Möglichkeiten begrenzt, genauso wie ein Verständnis
der Fehlerhaftigkeiten, der inneren Widersprüche, der Risse
dieses Systems absolut unerlässlich ist, um eine sinnvolle alternative
Arbeit zu machen. Das Alternative beinhaltet ja semantisch,
dass man sich abgrenzt vom Existierenden, und
um das sinnvoll zu tun, muss man ja die Fehler des Existierenden
erst mal begreifen, um dann einen besseren Weg einzugehen.
Meine Hoffnung gründet auf zwei Sachverhalte: Zum einen die
Geschichte der Freiheit. Es ist faszinierend zu sehen, dass Menschen
immer wieder gegen alle möglichen Widerstände in verschiedener
Weise aufbegehren. Wir haben das in den letzten
Jahren international erlebt, Stichwort Brasilien, arabische Welt,
Länder, in denen niemand, selbst die Spezialisten, das erwartet
hatten; Zum anderen mein Zweckoptimismus. Mit dem
enormen Privileg eines Schriftstellers, sehr viel Zeit zu haben,
beschäftige ich mich seit 20 Jahren mit dieser Entwicklung. Die
katastrophalen Folgen des globalisierten Kapitalismus sind
nicht Entwicklungen, die man achselzuckend wie medikamentöse
Nebenwirkungen hinnehmen kann. Die gegenwärtige Entwicklung
stellt das Wesen von Humanität an sich in Frage.“
Ausgebrannt – Ralf Oettmeier
Fakten, tatsächliche Hintergründe, Bewältigungs- und Vermeidungsstrategien zum Burnoutproblem.
BURNOUT ist in aller Munde. Kaum ein
Tag vergeht, an dem nicht neue Nachrichten
über den Ausstieg von prominenten
Sportlern, Trainern, Politikern, Managern
aus der Leistungsgesellschaft
erscheinen. Der Zustand totaler Überforderung
und Erschöpfung ist dabei nach
Kriterien der Universitätsmedizin noch
nicht einmal eine Diagnose, sondern nur
eine Störung. Diese zerstört aber viele
Existenzen, stürzt Familien ins Unglück,
fördert Firmenpleiten und ist schließlich
einer der Hauptursachen für Selbstmord.
Kaum einer der Leser wird nicht in seinem
Umfeld jemanden kennen, welcher
von der offenbar modernen Volksseuche
betroffen ist. Und betrachtet man unsere
finanzpolitische Situation national,
europäisch wie global, so lassen sich
hier erstaunliche Parallelen zum Burnoutproblem
der Menschen aufzeigen,
welche durch Aufstau von Problemen
und einem Unvermögen von dessen Lösung
gekennzeichnet sind. Als Arzt habe
ich mich zunächst den menschlich-medizinischen
Hintergründen gestellt. Bei
der tiefgründigen Ursachenforschung
kommt man jedoch nicht an finanzökonomischen
Zusammenhängen vorbei.
Vorbemerkungen und Definition
Definitionsgemäß beschreibt Burnout
einen Zustand anhaltender Überforderung
(Stress) mit Erschöpfung, Leistungsabfall,
innerer Distanzierung und
psychosomatischen Beschwerden. Es
handelt sich dabei im eigentlichen Sinne
nicht um eine anerkannte Krankheit,
sondern eine Lebenssituation ganz persönlicher
Art. In den Industriestaaten
nimmt diese Problematik stetig zu. Insbesondere
in Leistungsberufen
mit
einem Höchstmaß
an Verantwortung,
wie bei Ärzten, Führungskräften,
Verkaufsmanagement
und Politikern geht
man von einer Quote
von 30–40 % der
über 40-jährigen
aus. Auch bei Lehrern,
Anwälten und
in Pflegeberufen
wird eine hohe Rate
beobachtet. Nach
aktuellen Schätzungen sollen gegenwärtig
etwa 4 Millionen Deutsche Zeichen
dieses Überlastungs- und Schwächezustandes
haben. Nach Angaben
der Krankenkassen stellen die Burnouttypischen
Symptome, wie Depression,
psychische Störungen, psychosomatische
Erkrankungszeichen und Anpassungsstörungen
inzwischen die häufigste
Krankschreibungsursache (AOK:
22,5 Tage/Jahr) dar. Der entstehende
volkswirtschaftliche Schaden durch
Arbeitsausfall, verminderte Leistungsfähigkeit
und Totalausfall geht jährlich
in die Milliarden.
Zeit für etwas Neues – Pat Christ
Zum Jahresende verlässt Vorstandsfrau Sylke Schröder die EthikBank -
Verglichen mit der Deutschen Bank,
die eine Bilanzsumme von 2,2 Billionen
Euro ausweisen kann, ist die
EthikBank klein: Hier liegt die Bilanzsumme
bei unter 300 Millionen Euro.
Doch innerhalb des alternativen Bankensektors
hat sich die EthikBank einen
Namen gemacht. „Wir kommen in
der Wahrnehmung der Menschen heute
direkt hinter der GLS-Bank“, sagt
Sylke Schröder. Die Mitbegründerin
der EthikBank gehörte bisher dem
Vorstand an. Zum Jahresende will sie
die Bank verlassen.
Was nicht an einer sich womöglich
geänderten Unternehmensphilosophie
und auch
nicht an Clinch mit Kollegen liegt. Sylke
Schröder steht heute noch genauso
wie bei der Gründung vor zwölf Jahren
zu „ihrer“ Bank. 2002 wurde sie von
ihr und Klaus Euler als Zweigniederlassung
der Volksbank Eisenberg eG
gegründet.
Die Konstruktion bietet bis heute eine
besondere Sicherung der Kundengelder:
Zum gesetzlichen Einlagenschutz
kommt der Schutz durch die Sicherungseinrichtung
des Bundesverbandes
der Volksbanken und Raiffeisenbanken.
Besonders bei der EthikBank
ist aber auch, dass es seit 2005 eigene
MikroKonten für Insolvenzschuldner
gibt. Seit 2009 vergibt die EthikBank
eigene ÖkoBaukredite.
Banken haben einen schlechten Ruf,
weil immer wieder aufkommt, wie sie
tricksen. Sie nutzen jedes Schlupfloch
im Steuersystem aus, locken Anleger
in hochriskante Unternehmensbeteiligungen
und verschweigen versteckte
Kosten. Sich in diesem Haifischbecken
zu behaupten, ist eine gewaltige Herausforderung.
Sylke Schröder hat diese
Herausforderung mit ihren Kollegen
gemeistert. Darum hängt sie an „ihrer“
Bank. „Doch ich bin auch noch jung
genug, um etwas Neues anzufangen“,
meint die 48-Jährige. Erleichtert wurde
ihre Entscheidung, zu gehen, dadurch,
dass sie die Bank bei Klaus Euler und
Thomas Zahn in guten Händen weiß.
Auszeit auf dem Jakobsweg
Außerdem verlässt sie die EthikBank
in einer prosperierenden Phase. Auch
das macht den Ausstieg einfacher. Wie
es nach ihrem Abschied weitergehen
wird, steht noch nicht fest: „Ich werde
mir erst einmal für drei Monate eine Auszeit
nehmen.“ In dieser Zeit möchte Sylke
Schröder den Jakobsweg entlang von
Frankreich bis Santiago de Compostela
wandern. Und sich dabei überlegen,
was sie in Zukunft tun möchte. „Es gibt
unterschiedliche Optionen, die ich derzeit
sondiere“, sagt sie. Gern würde sie
etwas Kreatives machen: „Ich habe da
schon lange eine Geschäftsidee, die es
so noch nicht gibt. Die würde ich gerne
ausprobieren.“
Die Oligarchen kommen – Günther Moewes
2004 habe ich in meinem Buch „Geld oder Leben“ zweierlei darzustellen versucht: Wie und warum ein Finanzcrash unausweichlich war und weiter ist. Und warum der Spätkapitalismus ebenso
unausweichlich in eine Plutokratie, eine Oligarchenherrschaft münden muss, und diese wiederum in die Mafia. Damals wurde das als Schwarzmalerei und „Kulturpessimismus“ belächelt
oder ignoriert. Inzwischen hat die Realität meine Voraussagen weit überholt. Inzwischen besitzen die weltweit 85 reichsten Oligarchen so viel wie die halbe Menschheit und 1 % der Menschheit
(70 Mio.) besitzt die Hälfte des Weltvermögens. Sogenannte „OECD-Experten“ glauben zwar, in Deutschland seien die Verhältnisse günstiger, weil die einkommensstärksten 10 % der Bevölkerung
nur 6,7 mal so viel verdienen wie die einkommensschwächsten 10 % (OECD-Durchschnitt 9,5 mal so viel).
Aber das ist aus zwei Gründen falsch: Erstens wird die Ungleichverteilung nicht von den Einkommen bestimmt, sondern von den Vermögen. Und zweitens spielt sich die Ungleichverteilung
nicht zwischen den oberen und unteren 10 Prozent ab, sondern zwischen den obersten 1 Promille der Oligarchen und den übrigen 99,9 % der Bevölkerung. Die Vermögen dieser 1 Promille
haben sich seit etwa 1980 real verdoppelt. Und der US-Verteilungsforscher Paul Krugman schätzt, dass in den USA bereits ein Drittel der 50 größten Vermögen nicht erarbeitet, sondern
ererbt wurde und das zweite Drittel in den nächsten 20 Jahren vererbt werden wird.[New York Times, 4. 4. 2014] Ausführlich wurde die weltweite Ungleichverteilung von mir in der Ausgabe 2–2014 der „Humanen Wirtschaft“
dargestellt. Am gleichen Tag, als diese Ausgabe erschien, wurde auch die neueste Vermögensuntersuchung des DIW veröffentlicht. Sie zeigt, dass meine Zahlen über Armut und Reichtum noch
zu niedrig gegriffen waren. Inzwischen beschränken sich die Oligarchen nicht mehr darauf, im Geheimen auf den Finanzmärkten zu operieren und ihre meist leistungslos erwirtschafteten
privaten Milliarden diskret zu genießen. Sie beschränken sich auch nicht mehr darauf, ihre Direktiven in Davos, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, über Troikas, Stiftungen und Thinktanks unmissverständlich
an die Politik weiterzugeben. Oder in Caracas, Bangkok Kairo, Tunis oder Kiew die angeblichen Mittelschichtrevolten gegen gewählte Regierungen anzuzetteln. Mehr und
mehr steigen die Oligarchen, wie in den USA, Italien, Österreich oder jetzt in der Ukraine und der Slowakei ganz persönlich in die Politik ein. In Saudi-Arabien, den Emiraten und Brunei war
das ja schon immer so. Die West-Oligarchen und ihre Hausmedien versuchen auch, die Ost-Oligarchen (oder, wie DER SPIEGEL schrieb: „die russische Finanzelite“) gegen den „unbequemen Putin“
aufzuwiegeln, offensichtlich koordiniert, wie das plötzliche, zeitgleiche Auftauchen neuer Begriffsbildungen zeigt („Russlandversteher“, „Putinversteher“). Westliche Medien beschränken
den Begriff „Oligarchen“ auch gern auf Ostmilliardäre. Nachdem diese in der Ukraine ungewählt als „kommissarische“ Provinzfürsten eingesetzt wurden, machte ihnen der deutsche Außenminister flugs seine Aufwartung.
Wären Sie gerne reich, wenn Sie tot sind? – Editorial
Der weltweite Wirtschaftsleistungsmotor läuft heiß und heißer. Das Ziel lautet Wohlstand. Dafür scheint „Reichtum“ unentbehrlich zu sein. Diesem Ziel bringen wir Opfer.
Die Umwelt zum Beispiel. Oder die persönliche Gesundheit. Wir brennen uns aus, denn das Bestreben steht über allem: Wohlstand. Reichsein. Dabei sind wir längst so reich wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte.
Gleichzeitig müssen wir uns aber mit zunehmenden Armutsproblemen befassen. Mauern mit Stacheldraht umgeben die Paläste der Milliardäre. In gepanzerten Fahrzeugen werden ihre Kinder, in Städten wie São
Paulo, vorbei an den Blechhütten der Slums zur Schule gefahren. Auch in den wirtschaftlich leistungsfähigsten Ländern der Erde prallen unbegreifliche Gegensätze aufeinander.
Dabei erkennt man immer das identische Muster: protziger Luxus und beklagenswerte Bedürftigkeit zur selben Zeit am gleichen Ort. Reichtum ist auf tragische Weise ungleich verteilt. Warum ist das so?
Raymond Firth schrieb 1959 in seinen Studien zur Ökonomie der neuseeländischen Maori: „In den Wäldern von Neuseeland wie in den Savannen im Sudan, überall ist eines Realität: Familien, die Hunger erleiden müssen
oder denen es an Lebensnotwendigem fehlt, sind in einem Dorf unmöglich, in dem es Familien gibt, die üppig versorgt sind.“ Da drängt sich die Frage auf: Mit welchem Recht bezeichnen wir Naturvölker als „primitiv“?
„Reichtum und Armut gehören nicht in einen geordneten Staat“ erkannte der 1930 verstorbene Reformer Silvio Gesell im Laufe von Studien, die in sein Hauptwerk „Die Natürliche Wirtschaftsordnung“ mündeten.
Der Franzose Thomas Piketty ist 42 Jahre alt und gegenwärtig Wirtschaftsprofessor an der „Paris School of Economics“. Dieser Tage ist die englische Übersetzung seines Buches „Capital in the 21st century“ (Kapital im 21.
Jahrhundert) erschienen. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman aus den USA bezeichnet das Werk als eines, das die Art wie wir über Gesellschaft und Wirtschaft denken, grundlegend verändern werde.
Piketty untersuchte die Wirtschaftswachstumsprozesse über einen langen Zeitraum und glich die Ergebnisse mit der Entwicklung der Verteilung der Geldvermögen ab. Dabei stellte er fest, dass die Geldvermögen stets schneller
wuchsen, als die Wirtschaftsleistung. Bis zum Vorabend des 1. Weltkriegs war demnach das Kapital in Europa auf das 6- bis 7‑fache der gesamten Wirtschaftsleistung eines Jahres angewachsen. Eine Situation, die mit der heutigen
vergleichbar ist. Die wissenschaftliche Erkenntnis, die sich daraus ableitet, lautet: Wachsende Geldvermögen gehen grundsätzlich einher mit zunehmender Ungleichverteilung. Die Autoren der HUMANEN WIRTSCHAFT, allen voran Helmut
Creutz und der in der vorliegenden Ausgabe schreibende Günther Moewes, bestätigen in mittlerweile Jahrzehnte anhaltender Arbeit Pikettys jetzige Forschungsergebnisse. Der zu erwartende Erfolg des Wirtschaftswissenschaftlers
aus Paris wäre auch einer der akribisch im Hintergrund forschenden „freien Geister“, die sich – teilweise ein Leben lang – für die grundlegende Erneuerung des Geldsystems und des Bodenrechts einsetzen. Schließlich kamen
sie zu gleichen Ergebnissen, nur ohne die Unterstützung eines Wissenschaftsbetriebs. Thomas Piketty scheint der richtige Mann zum passenden Zeitpunkt zu sein. Das „Handelsblatt“ traut ihm
zu, er werde „Epoche machen“ und der englische „Guardian“ meint, er versenke „rigoros alles, was Kapitalisten über die Ethik des Geldmachens denken“. Er kann es demnach schaffen, auf höchster Ebene Bewegung in die
vermutlich zentralste Aufgabe der Neuzeit zu bringen: die Erforschung des Geldsystems und dessen Folgen. Können wir eine Katastrophe, wie sie sich vor 100 Jahren schon einmal anbahnte noch abwenden?
Wenn die Raten des Geldvermögenswachstums dauerhaft über jenen des Wirtschaftswachstums liegen „neigt die Vergangenheit dazu, die Zukunft zu verschlingen“, konstatiert Piketty. Das Schicksal unserer Gesellschaft
ist geprägt von der Dominanz ererbten Geldvermögens. Wer tot ist, den hat die Vergänglichkeit des Lebens eingeholt. Die Ansprüche der Geldvermögen von Toten wachsen generationenübergreifend weiter. Thomas Piketty
empfiehlt eine weltweit organisierte Vermögenssteuer gegen die Reichtumskonzentration. Das dürfte ein hinreichendes Instrument für den erforderlichen schnellen Eingriff darstellen. Löst man damit das ursächliche Problem
auf Dauer? Wenn Geldvermögen (Kapital) sich infolge Zins und Zinseszins von selbst vermehren und wachsende Ansprüche an zukünftige Leistungen von Menschen stellen, dann kann das Abschöpfen infolge leistungsloser Einkommen
entstandenen Kapitals nur der erste Schritt sein. Warum sollten wir dabei stehen bleiben und nur versuchen, die Ergebnisse eines ungerechten und fehlerhaften Systems wieder zu verteilen, anstatt nicht direkt derlei Erträge
durch Systemänderungen zu verhindern? Viele freie Geister und Verfechter einer humanen Wirtschaft befassen sich mit den Ursachen der Ungleichverteilung. Sie erarbeiten dabei auch Lösungsvorschläge.
Alles deutet darauf hin, dass die Wirtschaftswissenschaften nachziehen können.
Herzlich grüßt Ihr Andreas Bangemann
Leserbriefe 02/2014
Ihre Meinung ist uns wichtig! Senden Sie uns Ihre Fragen, Anregungen oder persönlichen Meinungen. Wir bemühen uns, so viele Leserbriefe unterzubringen, wie möglich. Wenn wir Leserbriefe kürzen, dann so, dass das Anliegen der Schreibenden gewahrt bleibt. Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.
Zum Artikel „Geht es auch ohne Geld?“ – Da wird meiner Meinung nach kräftig übers Ziel hinausgeschossen.
Ich sehe das pragmatischer. Sicher ist der Mensch Teil der Natur,
was bedeutet, dass er morgens wenn er aufgestanden ist, Hunger
hat und sich aufmachen muss (etwa arbeiten gehen?) um was
Essbares zu finden. In der heutigen Zeit der arbeitsteiligen Gesellschaft
(finde ich gar nicht so schlecht) gehe ich um die Ecke zu meinem
Bäcker. Was aber wenn der Bäcker keine Lust hat und heute
lieber faul sein möchte? Und die Kassiererin bei ALDI auch, dann
habe ich ein Problem. Geld an sich ist eine gute Erfindung, es darf
sich nur nicht von alleine vermehren, es soll nur Tauschmittel sein…
Papst Franziskus – Wegbereiter für die Überwindung der Dominanz des Ökonomischen? – Christoph Rinneberg
Seit dem 24. November 2013 geht ein
Text um die Welt, den wohl kirchennahe
und erst recht kirchenferne Menschen
der katholischen Kirche kaum zugetraut
haben. Es ist das erste „Apostolische
Schreiben“ des neuen Papstes in Rom,
der als erster sich durch seine Namensgebung
mit Franziskus von Assisi verbindet.
Vor rund 800 Jahren hat dieser
Francesco („kleiner Franzose“), wie ihn
seine Eltern liebevoll nannten, durch
sein radikales „Verlassen der Welt“
sein neues Verständnis von „Gott und
Mensch“ wieder in diese Welt gebracht
und durch sein Leben beglaubigt. Wegen
seiner Glaubwürdigkeit hatten
manche seiner Zeitgenossen in ihm gar
einen zweiten Christus gesehen.
Mit den Worten „Die Freude des
Evangeliums sei immer in euren
Herzen“ lädt Papst Franziskus
alle „christgläubigen“ Menschen
ein, sich auf „Evangelii Gaudium“, die
Freude des Evangeliums einzulassen
– und könnte damit kaum protestantischer
sein. Evangelium – übersetzt:
frohe Botschaft – ist zum Begriff für
eine Überwindung der Existenzängste,
für eine Befreiung von TINA-diktierten
– „There Is No Alternative“ – sog. Sachzwängen
geworden. Der neue Papst
hat im Grunde von den ersten Minuten
an in seinem Amt durch ebenso überraschende
wie glaubwürdige Gesten
dafür gesorgt, dass seine Worte kaum
Barrieren zu überwinden haben, um
auch bei Menschen anzukommen, die
sich nicht als „christgläubig“ verstehen.
Damit hat der Papst kein Wunder
vollbracht, er hat sich „nur“ voll und
ganz – in Dietrich Bonhoeffers Sinne –
der Diesseitigkeit dieser Welt und der
Aufgabe der christlichen Kirchen in dieser
Welt gestellt: Leben geht vor Lehre,
könnte man seine so überraschend
neu klingende Botschaft auf den Punkt
bringen.
In dieser Betrachtung der umfangreichen
– in 288 Absätze gegliederten
und mit 217 Literaturverweisen versehenen
– päpstlichen Botschaft soll es
in erster Linie um die Abschnitte 52 bis
60 gehen, in denen „Einige Herausforderungen
der Welt von heute“ thematisiert
werden. Diesen rund 3 Seiten Text
kann man unschwer eine der ärztlichen
Professionalität entliehene Gliederung
nach Symptom, Anamnese, Diagnose
und Therapie unterlegen:
Zu den Symptomen erfahren wir:
„Die Menschheit erlebt im Moment eine
historische Wende, die wir an den Fortschritten
ablesen können, die auf verschiedenen
Gebieten gemacht werden.
Lobenswert sind die Erfolge, die zum
Wohl der Menschen beitragen, zum Beispiel
im Bereich der Gesundheit, der Erziehung
und der Kommunikation. Wir
dürfen jedoch nicht vergessen, dass der
größte Teil der Männer und Frauen unserer
Zeit in täglicher Unsicherheit lebt,
mit unheilvollen Konsequenzen. Einige
Pathologien nehmen zu. Angst und Verzweiflung
ergreifen das Herz vieler Menschen,
sogar in den sogenannten reichen
Ländern. Häufig erlischt die Lebensfreude,
nehmen Respektlosigkeit und Gewalt
zu, die soziale Ungleichheit tritt immer
klarer zutage. Man muss kämpfen, um
zu leben – und oft wenig würdevoll zu leben….“
(52)
Ergänzend hierzu wird in den folgenden
Absätzen u. a. der Hunger in der Welt,
das Wegwerfen von Lebensmitteln, die
Spekulation mit Nahrungsmitteln, die
Zunahme des Reichtums Weniger und
der Verarmung Vieler, die ökonomische
Ausbeutung und die soziale Unterdrückung
angeführt.
Die Anamnese ist nicht weniger deutlich:
„Dieser epochale Wandel ist verursacht
worden durch die enormen Sprünge, die
in Bezug auf Qualität, Quantität, Schnelligkeit
und Häufung im wissenschaftlichen
Fortschritt sowie in den technologischen
Neuerungen und ihren prompten
Anwendungen in verschiedenen Bereichen
der Natur und des Lebens zu verzeichnen
sind. Wir befinden uns im Zeitalter
des Wissens und der Information,
einer Quelle neuer Formen einer sehr oft
anonymen Macht.“ (52)
Weiter lesen wir:
Das herrschende „Ungleichgewicht geht
auf Ideologien zurück, die die absolute
Autonomie der Märkte und die Finanzspekulation
verteidigen. Darum bestreiten
sie das Kontrollrecht der Staaten, die
beauftragt sind, über den Schutz des Gemeinwohls
zu wachen. …“(56)
Die Diagnose bietet für jedermann nachvollziehbare
Erklärungen:
Die unübersehbare, zunehmende soziale
Ungleichheit hat sich nicht einfach so
ergeben:
„… Heute spielt sich alles nach den Kriterien
der Konkurrenzfähigkeit und nach
dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der
Mächtigere den Schwächeren zunichte
macht. Als Folge dieser Situation sehen
sich große Massen der Bevölkerung ausgeschlossen
und an den Rand gedrängt:
Ohne Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg.
Der Mensch an sich wird wie ein
Konsumgut betrachtet, das man gebrauchen
und dann wegwerfen kann. Wir haben
die ‚Wegwerfkultur‘ eingeführt, die
sogar gefördert wird. Es geht nicht mehr
einfach um das Phänomen der Ausbeutung
und der Unterdrückung, sondern
um etwas Neues: Mit der Ausschließung
ist die Zugehörigkeit zu der Gesellschaft,
in der man lebt, an ihrer Wurzel getroffen,
denn durch sie befindet man sich nicht in
der Unterschicht, am Rande oder gehört
zu den Machtlosen, sondern man steht
draußen. Die Ausgeschlossenen sind
nicht ‚Ausgebeutete‘, sondern Müll, ‚Abfall‘.“
(53)
Die „Trickle-Down-Theorie“ geht davon
aus, „dass jedes vom freien Markt begünstigte
Wirtschaftswachstum von sich
aus eine größere Gleichheit und soziale
Einbindung in der Welt hervorzurufen vermag.
Diese Ansicht, die nie von den Fakten
bestätigt wurde, drückt ein undifferenziertes,
naives Vertrauen auf die Güte
derer aus, die die wirtschaftliche Macht in
Händen halten, wie auch auf die vergötterten
Mechanismen des herrschenden
Wirtschaftssystems. … Um einen Lebensstil
vertreten zu können, der die anderen
ausschließt, … hat sich eine Globalisierung
der Gleichgültigkeit entwickelt. Fast
ohne es zu merken, werden wir unfähig,
Mitleid zu empfinden gegenüber dem
schmerzvollen Aufschrei der anderen, wir weinen nicht mehr angesichts des Dramas
der anderen, noch sind wir daran
interessiert, uns um sie zu kümmern, als
sei all das eine uns fern liegende Verantwortung,
die uns nichts angeht. Die Kultur
des Wohlstands betäubt uns….“ (54)
Ein Grund für die in (54) geschilderte Situation
„… liegt in der Beziehung, die wir
zum Geld hergestellt haben, denn friedlich
akzeptieren wir seine Vorherrschaft
über uns und über unsere Gesellschaften.
Die Finanzkrise, die wir durchmachen,
lässt uns vergessen, dass an ihrem
Ursprung eine tiefe anthropologische Krise
steht: die Leugnung des Vorrangs des
Menschen! Wir haben neue Götzen geschaffen.
Die Anbetung des antiken goldenen
Kalbs (vgl. Ex. 32, 1–35) hat eine
neue und erbarmungslose Form gefunden
im Fetischismus des Geldes und in
der Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht
und ohne ein wirklich menschliches
Ziel. Die weltweite Krise, die das Finanzwesen
und die Wirtschaft erfasst, macht
ihre Unausgeglichenheiten und vor allem
den schweren Mangel an einer anthropologischen
Orientierung deutlich – ein
Mangel, der den Menschen auf nur eines
seiner Bedürfnisse reduziert: Auf den
Konsum.“ (55)
Kant nennt es „Unrecht“ – Thomas Mohrs
Warum die Geheimverhandlungen über das Handelsabkommen TTIP ein Kulturbruch sind und warum die Philosophie Einspruch erhebt.
Wie hieß das doch beim alten Kant:
„Alle auf das Recht anderer Menschen
bezogene Handlungen, deren Maxime
sich nicht mit der Publicität verträgt,
sind Unrecht.“ Übersetzt: Jegliche
politische Maßnahme, die vor
ihrer Implementierung das Licht der
Öffentlichkeit scheuen muss, ist per
definitionem Unrecht. 1795 hat Immanuel
Kant das geschrieben, in seinem
„Ewigen Frieden“, einer der ersten
echten Globalisierungs-Theorien. Und
irgendwie ist noch immer was dran an
dieser „Publizitäts“-These.
Nehmen wir zum Beispiel diese
„Transatlantic Trade and Investment
Partnership“ (TTIP), das
größte „Freihandelsabkommen“ aller
Zeiten, das gerade zwischen der EU und
Nordamerika ausgehandelt wird. Nein:
Nennen wir das Kind beim Namen:
das gerade übern großen Teich hinweg
in Brüssel und Washington ausgemauschelt
wird. Unter Ausschluss
der Öffentlichkeit, geheim, hinter verschlossenen
Türen. Abgeschirmt von
Vertretern demokratisch gewählter
Parlamente und erst recht von NGOs
und Verbraucher- und Konsumentenschutzverbänden.
Denn die könnten den versammelten
Lobbyisten der globalen Konzerne
und Investoren womöglich in die Suppe
spucken – in die Hühnersuppe gewissermaßen.
Denn: Wenn das funktioniert
mit der TTIP (bzw. der TAFTA:
Transatlantic Free Trade Area), dann
können sich beispielsweise amerikanische
Fleischkonzerne mit ihren
Chlorhühnern, die derzeit in Europa
aufgrund der strengeren Hygiene-
Standards verboten sind, in den europäischen
Markt einklagen. Einfach
so, weil diese „überzogenen“ europäischen
Standards ein Chlorhuhn-Investitionshemmnis
darstellen und damit
zukünftige mögliche Gewinne der Konzerne
gefährden.
Und wenn ein europäischer Staat sich
weigern sollte? Dann entscheidet nicht
die nationale oder die europäische Gerichtsbarkeit,
sondern im Rahmen des
Freihandelsabkommens organisierte
Tribunale, beschickt von internationalen
Anwaltskanzleien, deren Vertreter
heute Kläger, morgen Verteidiger,
übermorgen Richter sind. Und wenn
das von der Weltbank (!) beaufsichtigte
Tribunal entscheidet, dass der renitente
Staat die „erwarteten künftigen
Profite“ des Konzerns XY „unrechtmäßig“
gefährdet, dann ist dieser Staat
gezwungen, seinen Markt für das
strittige Produkt – ob Chlorhuhn, Hormonfleisch,
genverändertes Saatgut,
„großzügig“ geprüfte Pharmaprodukte,
Benzin mit toxischen Zusatzstoffen
or whatever – zu öffnen. Oder millionenschwere
Entschädigungen zu zahlen.
Aus Steuergeldern, versteht sich.
Ein Witz zur Faschingszeit? Schön
wär’s, wenn auch nur bedingt lustig.
Nein, es ist kein Witz und lustig
schon gar nicht: Was mit dem TTIP auf
uns zukommt, ist – wie es „Le Monde
diplomatique“ formuliert – ein
„Staatsstreich in Zeitlupe“, die klammheimliche
Installation einer „Wirtschafts-
NATO“, deren Befugnisse
buchstäblich grenzen-los sind. Es ist ein Kultur-Bruch von fundamentalem
Ausmaß: die totale Unterwerfung
des Primats der Politik unter das
Primat der Wirtschaft.
Daher ist es nötig, das Monstrum TTIP
als „auf das Recht anderer Menschen
bezogene Handlung“ ins Licht der Öffentlichkeit
zu stellen, um zu zeigen,
was es ist: Unrecht!
Vision oder Privatvergnügen? – Pat Christ
Leben ohne Geld und möglichst ohne Bedürfnisse wird zum neuen Nischenlifestyle.
Er wollte nicht länger um das Goldene
Kalb tanzen. Darum entschied sich
Raphael Fellmer vor drei Jahren, in
„Geldstreik“ zu treten. Seither macht
er damit Furore. Wobei er keineswegs
der einzige ist, der sich (vorübergehende?)
„Geldlosigkeit“ zum Ideal
erkoren hat. Heidemarie Schwermer
entschied sich bereits 1996, ohne
Geld zu leben. Mark Boyle gab immerhin
ein Jahr lang den Konsumverweigerer.
Auch die Vagabundenbloggerin
Michelle stieg für ein Jahr aus und lebte
ohne Heller und Pfennig.
Einmal ausscheren – wer wünschte
sich das nicht. Dazu hat auch
jeder das Recht. Interessant sind
die Missionen, die hinter dem jeweiligen
Ausstieg stecken. So hat Raphael
Fellmer mit seiner Aktion die „Lage
der Welt“ und die ganze Menschheit im
Blick. Darunter macht er es nicht. „Mein
Geldstreik ist sehr breit angelegt“,
meint er im Gespräch mit der HUMANEN
WIRTSCHAFT. Er ist gegen den Kapitalismus.
Gegen die Verschwendung.
Gegen die Ausbeutung von Tieren. Gegen
die Umweltverschmutzung. Als ein
„Ausrufe- und ein Fragezeichen“, sagt
er uns, sehe er seinen Streik.
Fellmer trampte längere Zeit und kam
dadurch auf den Geschmack der Freiheit
und zu seiner Lebensphilosophie.
Man lerne die Dinge mehr zu schätzen,
wenn man sie nicht einfach kaufen kann,
meint er. „Wenn zum Beispiel beim Trampen
endlich ein Auto hält, freut man sich
viel mehr, als wenn man einfach in den
nächsten Bus steigt und 2,50 Euro zahlt“,
so der 30-Jährige. Das leuchtet ein.
Und es erinnert an „On The Road“, die
Bibel der Beat-Generation. Auch hier
nehmen sich junge Menschen eine
Freiheit, die ihnen die Gesellschaft
freiwillig nicht gibt. Aber dieses Buch
kennt Fellmer nicht. „Ich bin nicht sehr
belesen“, gibt er zu. Und das ist spürbar.
Überhaupt hat es Fellmer nicht mit
Theorien und Philosophien.
Einfach gestricktes Weltbild
Sein einfach gestricktes Weltbild weist
ihn denn auch nicht gerade als Feingeist
aus. Da gibt es die wenig anspruchsvollen
Kategorien „Ja“ beziehungsweise
„gut“ und „Nein“ beziehungsweise
„schlecht“. Raphael Fellmer ist gegen
alles, was nicht gut ist: Den millionenfachen
Hunger in der Welt, das „Killen“
von Tieren, die Zerstörung der Natur.
Und er ist für alles, was gut ist. Die Liebe.
Die Menschheit. Und dergleichen.
Dass er auf alles eine Antwort parat hat,
wirkt ein wenig oberschlau. Oberfriedlich
und oberökologisch ist er sowieso.
Nur mit Details, stets die Krux an jeder
Problematik, hält er sich nicht lange
auf. Irgendwie scheint es für ihn nichts
tiefer zu verstehen zu geben… Das ist
entwaffnend. Dafür mögen ihn viele. Ist
doch die Sehnsucht nach einfachen Erklärungen
und einfachen Lösungen in
unserer hochkomplexen Welt groß. Und
wer möchte Kämpfer für das Gute nicht
gern unterstützen?
Seine Habe musste er vor seinem Freiheitssprung
übrigens nicht in einem Depot
unterbringen. Fellmer hat ein Dach
überm Kopf. Bis Ende vergangenen
Jahres lebte er mit seiner Frau und der
zweijährigen Tochter Alma umsonst im
Friedenshaus von Berlin. Zu Jahresbeginn
zog er um. Eine Familie nahm die
drei auf: „Wir haben dort ein Zimmer in
einer Fünf-Zimmer-Wohnung.“ Zu eng?
Aber Fellmer ist ja ohnehin dauernd
unterwegs. Vor allem seit sein Buch erschienen
ist. Daran verdient er im Übrigen
nicht, betont er uns gegenüber. Als E‑Book sind die Seiten kostenlos herunterzuladen.
Von der Auflage wird ein
Drittel verschenkt. Der Rest fließt zur
Kostendeckung an den Verlag.
Den Ausschlag für die Entscheidung,
geldlos zu leben, gab eine Tramptour
mit Freunden nach Mexiko. „Er hatte
kein Geld, kam aber trotzdem immer
weiter“, schreibt Birgit Baumann über
ihn im „Standard“. „Über den Atlantik
nahmen ihn Italiener mit dem Segelboot
mit, in Brasilien saß er hinten auf alten
Lastwagen. Er schlief bei der Feuerwehr
und in Schulen, von Restaurants nahm
er sich, was ohnehin übrig war. Im Gegenzug
bot er seine Arbeitskraft an.“
Wer hätte auf solche Sensationen in der
großen weiten Welt in jungen Jahren
keine Lust? Die meisten jungen Abenteurer
allerdings lassen es bei einem
einmaligen Erlebnis bewenden. Nicht
so Raphael Fellmer. Er beschloss nach
seiner Rückkehr, fortan auch in Berlin
geldlos zu leben.
Verdientes Denkmal für einen großen Freiwirtschafter – Buchrezension von Heinz Girschweiler
Andreas Müller beleuchtet Leben und Gedanken Friedrich Salzmanns in einer Biografie.
Er war ein kleiner, feiner Mann, dazu
ein Leben lang körperlich behindert:
Deshalb zählt Friedrich Salzmann
(1915–1990) nicht zu den lauten und
vordergründig nicht zu den bekanntesten
Köpfen unter den Schweizer
Freiwirtschaftern. Fritz Schwarz, Hans
Konrad Sonderegger, Hans Bernoulli,
Werner Schmid und Werner Zimmermann
stehen für viele in dieser ersten
Reihe. Zu ihnen gehört aber unzweifelhaft
auch Friedrich Salzmann. Wer
es nicht ohnehin schon wusste, dem
macht dies die neu erschienene Biografie
klar.
Der Sohn eines Schweizer Kaufmanns
– in Persien geboren, in
Berlin und in der Schweiz aufgewachsen
– hat ein beeindruckendes
schriftliches Werk hinterlassen,
und er setzte sich ein Leben lang für
die Umsetzung der Erkenntnisse Silvio
Gesells ein.
Schon in der Jugend infiziert
Salzmann kam schon im Elternhaus
mit den freiwirtschaftlichen Ideen
in Kontakt. Ja er begegnete als Jüngling
auch noch Silvio Gesell, kurz vor
dessen Tod. So war es für den aufgeweckten
jungen Mann eine Selbstverständlichkeit,
sich in der freiwirtschaftlichen
Jugendbewegung zu
engagieren. Und früh schon trat er
nach einer kaufmännischen Lehre
auch als Redner an öffentlichen Veranstaltungen
auf. Als blutjunger Korrespondent
in Paris berichtete er für
das „Freie Volk“ über die große Politik
im Vorkriegsfrankreich. Nach seiner
Rückkehr trat er – an der Seite des
legendären Fritz Schwarz – in die Redaktion
des freiwirtschaftlichen Organs
ein. Er prägte es entscheidend
mit. Und er war – zusammen mit Werner
Schmid – treibende Kraft bei der
Gründung der Liberalsozialistischen
Partei (LSP) im Jahre 1946. Denn Salzmann
war überzeugt, dass man sich
politisch einmischen musste, wenn
man die gute Sache vorwärtsbringen
wollte.
Als in den Fünfzigerjahren die wirtschaftliche
Basis für die freiwirtschaftliche
Wochenzeitung zusehends
schwand, fasste Salzmann
schweren Herzens einen Entschluss:
Er folgte einem Ruf des Schweizer Radios
und trat in deren Inlandredaktion
ein. Weil er dank seiner weltläufigen
Erziehung ein ausgesprochen
gepflegtes Hochdeutsch sprach und
über eine tiefe, ruhige Stimme verfügte,
war er fürs Radio geboren.
Und Salzmann blühte in diesem Medium
auf. Er wurde zum anerkannten
Chef der Inlandabteilung, er moderierte
politische Streitgespräche,
und er führte die erste kritische Sendung
für Konsumenten ein. „Mit kritischem
Griffel“ hieß sie und wurde zur
damals besten Sendezeit am frühen
Samstagnachmittag ausgestrahlt.
Dann, 1971, wurde er auf der Liste des
Landesrings der Unabhängigen in
Bern überraschend in den Nationalrat
gewählt. Dort fiel er als seriöser
Arbeiter in den Kommissionen (etwa
zum Medienrecht) und als unerbittlicher
Kritiker der bundesrätlichen
Wirtschafts- und Konjunkturpolitik
auf. Dann kam zu seiner Behinderung
durch eine Kinderlähmung noch die
Parkinson-Krankheit hinzu, und er
musste deshalb 1978 schweren Herzens
aus dem Nationalrat zurücktreten.
Die folgenden Jahre waren dann
– er hatte seine geliebte Gattin, Gefährtin
und Betreuerin Hilde Grünig
schon früh verloren – von einer zunehmenden
Vereinsamung geprägt.
Seine letzten fünf Jahre verbrachte er
in einem Berner Pflegeheim.
Radikaler Denker
Neben seinem beruflichen Wirken
und der direkten politischen Arbeit
steht das schriftstellerische Werk
Salzmanns. Er hat rund ein Dutzend
Bücher geschrieben, dazu zahlreiche
Schriften und Tausende von Artikeln.
In „Bürger für die Gesetze“ (1949)
setzt sich der leidenschaftliche Liberale
kritisch mit dem Staat als Erzieher
auseinander und fordert einen
freien Bildungsmarkt. In „Jenseits der
Interessenpolitik“ (1953) widmet er
sich der grossen Auseinandersetzung
zwischen Kommunismus und Kapitalismus
und plädiert für eine wahrhaft
liberale Wirtschaftsordnung mit
starken staatlichen Leitplanken. Und
in „Mit der Freiheit leben“ (1961) vertieft
er diese Auseinandersetzung
zwischen den beiden rivalisierenden
Gesellschaftssystemen und fordert
seinen radikal liberalsozialen dritten
Weg.
Salzmanns Biograf weist mit Recht
auf dessen letzte Schrift „Gedanken
zu einer lebenswerten Zukunft“
(1985) als eigentliches gedankliches
Vermächtnis hin. Die programmatische
Schrift fasst die Positionen der
Liberalsozialisten – wohlbegründet
und konzentriert – zusammen. Sie
entstand in enger Zusammenarbeit
mit dem damaligen Sekretär der Partei,
Hans Barth. Der Einleitungssatz
ist typisch für das Bürgerverständnis
des philosophisch denkenden und
02/2014 www.humane-wirtschaft.de 37
politischen handelnden Menschen
Friedrich Salzmann:
„Wir sind nicht nur verantwortlich
für das, was wir tun, sondern
auch für alles, was wir widerspruchslos
dulden.“
Der spaltende Geist und das Geldsystem – Peter Berner
Für eine Diskussionskultur im Geiste integraler Wahrheitsfindung.
Meine vorangestellten Ausführungen
über den Umgang mit Bösem und Gutem
in unserer politischen Kultur („Vom
spaltenden Geist zu integraler Politik“,
HUMANE WIRTSCHAFT 01/2014) endeten
mit einer Beschreibung der positiven
Erfahrung, die ich mit der Dialog-
Methode nach David Bohm in einer
Gesprächsgruppe zum Thema „Integrale
Politik“ gemacht habe. Hier wurde
modellhaft jene „integrale Wahrheitsfindung“
praktiziert, die ich für
geeignet halte, den spaltenden Geist,
welcher unsere politische Kultur heute
beherrscht, zu überwinden und ein
humanes, friedvolles, nachhaltig wirtschaftendes
Gemeinwesen zu entwickeln
und zu gestalten.
Integrale Wahrheitsfindung
Wieso müssen wir uns über Wahrheitsfindung
überhaupt Gedanken machen?
„Wenn ich wissen will, ob es draußen
regnet, gehe ich ans Fenster und schaue
nach“, sagt Ken Wilber, und wenn du
mich nach dem Weg zum Bahnhof fragst
und ich ihn kenne und dir zeige, wissen
wir hinterher beide, was vorher nur ich
wusste. Wo also liegt das Problem? Nun
– überall dort, wo ein Bereich der Wirklichkeit
komplexer wird und nicht mehr
durch einen einfachen Erkenntnisakt zu
erfassen ist wie das gegenwärtige Wetter
oder der Weg zum Bahnhof, wird es
natürlich etwas schwieriger. Und dies
ist mit vielen Wirklichkeitsbereichen,
mit denen wir uns als menschliche Gemeinschaften
befassen, eben der Fall –
von der Gestaltung eines Gartens über
die Leitung eines Unternehmens bis hin
zum Design des weltweiten Geldsystems
oder gar einer gezielten Beeinflussung
des Erdklimas.
In einem solchen Fall kann jede® der
Beteiligten in der Regel nur einen Teil
der Wirklichkeit, die gerade zu untersuchen
oder zu gestalten ist, erkennen
und verstehen – was ebenfalls
so lange unproblematisch ist, wie ich
als Betroffene® mir dessen bewusst
bin, wo die Grenzen meines Wissens
liegen. Genau hier aber setzen die
Schwierigkeiten ein, mit denen wir im
gesellschaftlichen Leben oft zu tun bekommen,
sei es im Alltag, in der Wissenschaft
oder in der Politik. Problematisch
wird es nämlich dann, wenn
die Menschen, die an einem gemeinsamen
Prozess der Wahrheits- und
Entscheidungsfindung beteiligt sind,
ihr jeweiliges persönliches Teilwissen
(ihre „Halbwahrheit“) fälschlich mit
der gesamten Wahrheit gleichsetzen.
Daraus entsteht ein Habitus, den ich
als „Hochmut der Halbwahrheit“ bezeichnen
möchte. Dieser kann auf unterschiedliche
Weise gelebt werden,
sei es ganz offen als missionarische
Haltung, welche die anderen überzeugen
und „bekehren“ will oder eher indirekt
als jene in der Politik „demokratischer“
Gesellschaften heute gängige
Haltung, welche versucht, durch Manipulations-
und Machtmittel verschiedener
Art Mehrheiten (oder einflussreiche
Minderheiten) hinter der eigenen
Position zu versammeln.
Denn es ist nicht allein die Komplexität
der Tatsachen, die eine Wahrheitsfindung
erschwert. Wir Menschen
haben seit vielen Jahrtausenden billigend
unterstützt oder aktiv daran mit
gearbeitet, dass unsere geistig-seelische
Schöpferkraft an priesterliche
Hierarchien oder technische Systeme
delegiert und infolgedessen weitgehend
degeneriert wurde. Dies begann
mit der Einführung der Schrift
in den alten Hochkulturen, die gemäß
der Warnung damaliger Weiser
tatsächlich kollektiv unser Gedächtnis
schwächte und endet wahrscheinlich
noch nicht bei den heutigen Navigationssystemen,
die beginnen,
unsere Fähigkeit zu räumlicher Orientierung
verkümmern zu lassen. Eine
herausragende Rolle spielt dabei
das Verkümmern unseres Wahrheitssinnes
durch einen weitgehenden Verlust
unserer „Seelenverankerung“,
unserer inneren Verbindung mit jenem
transzendenten Seinsgrund, dem wir
entstammen, und damit eine Schwächung
unserer ureigensten Gewissensbindung
oder moralischen Urteilskraft
– und deren Abtretung an äußere Hierarchien,
zunächst an die Priester
der verschiedenen Religionen, heute
zunehmend an die Experten der materialistischen
Wissenschaft und die Produzenten der modernen Massenmedien,
wobei ich diese beiden Systeme
zusammengefasst als „Wahrheitsindustrie“
bezeichnen möchte.
Wer heute die Welt, in der wir leben,
möglichst ganzheitlich verstehen will,
muss zwei Schleier durchstoßen: zum
einen den psychologischen Schleier
aus Versuchungen zu Scham, Schuldgefühlen,
ohnmächtiger Resignation,
panischer Angst, privatisierender Gier,
heiligem Zorn oder selbstgerechter,
das Böse auf Gegner projizierender
Fehlersuche, der sich oft vor eine ungeschminkte
Erkenntnis der Tatsachen
schiebt – zum anderen den Schleier der
veröffentlichten Meinung, den die oben
genannte Wahrheitsindustrie über uns
ausbreitet. Und groß ist die Versuchung,
alternative Wahrheitssuche so
zu betreiben, dass das Modell „hier
Expertentum – dort gläubige Gefolgschaft“
einfach kopiert und mit anderen,
scheinbar besseren oder richtigeren
Inhalten versehen wird – und dann
versucht wird mit den großen Systemen
in Konkurrenz zu gehen (was in der Regel
in Einverleibung oder Vernichtung
der alternativen Herausforderung endet),
anstatt diese Dynamik grundsätzlich
zu transzendieren.
Dies nämlich erfordert einen Weg, den
ich „Demut der Halbwahrheit“ nennen
würde. Hier eben betreten wir den Bereich
dessen, was ich[1] als „integrale
Wahrheitsfindung“ bezeichnen möchte.
Denn hier wählen wir als Beteiligte
eine Grundhaltung, die besagt: Da ich
davon ausgehen kann, dass ich allein
die komplexe Wirklichkeit nicht überblicke
(auch wenn es noch so sehr den
Anschein haben mag), da es aber für
eine gute Entscheidung des Gemeinwesens
wichtig ist, dass wir der jeweils
zutreffenden Wahrheit so nah wie möglich
kommen, bin ich als Teil dieses Gemeinwesens
essenziell darauf angewiesen,
dass auch alle anderen Beteiligten
ihre Teilwahrheit, ihren Zugang zum
Ganzen, ebenfalls in den „Pool“ hinein
geben. Das bedeutet praktisch: Wer
eine profilierte Position bezieht, die mir
befremdlich erscheint, löst nicht mehr
– wie bisher üblich – den Reflex aus,
ihn in die richtige Schublade einzuordnen
und mir damit gegebenenfalls vom
Leib zu halten, sondern wird innerlich
1 in Anlehnung an die integrale Philosophie nach Jean
Gebser, Ken Wilber und anderen
willkommen geheißen als eine Person,
die – über die Stimme ihres Gewissens,
welche jede(n) Einzelne(n) an das universelle
Bewusstsein zurück bindet
– die Wahrheitsfindung der Gemeinschaft
vervollständigt.
Unvergängliche Spuren am Strand des Lebens – Die Redaktion
In memoriam Margrit Kennedy.
Am 28. Dezember 2013 verstarb
Margrit Kennedy in ihrem Zuhause
in Steyerberg an Krebs.
Bereits Ende der 70er Jahre begann
sie, innerhalb der beruflichen Tätigkeit
als Architektin und Stadtplanerin
die ökologischen Fragen in
den Mittelpunkt ihres Wirkens zu stellen.
Ihr Leben bekam jedoch ab 1982
eine unvorhersehbare Wendung. Sie
entdeckte die Ursachen für jene Auswirkungen,
die ihre Arbeit als umweltbewusst
denkende Wissenschaftlerin
und Planerin stets maßgeblich und vor
allen Dingen negativ beeinträchtigten
im herrschenden Geldsystem. Sie war
überzeugt, dass die Mechanismen einer
auf unendliches Wachstum ausgerichteten
Wirtschaft niemals mit den
Erfordernissen eines respektvollen
und wertschätzenden Umgangs mit
der Natur vereinbar sind. Auch erkannte
sie, wie die zunehmenden sozialen
Verwerfungen eng mit dem Geldsystem
zusammen hingen, das vor allen
Dingen zu einem prädestiniert war:
Immense Geldvermögen bei einer verschwindend
geringen Zahl von Menschen
zu kumulieren. Und das auf Kosten
und zu Lasten der Gesamtheit. Die
berufliche und gesellschaftliche Stellung
erlaubte es ihr, sich auf wirkungsvolle
Weise für Veränderungen starkzumachen.
Doch Margrit Kennedy beließ
es nicht bei theoretischen Forderungen
an abstrakte Adressaten.
Sie ergriff Initiative und nutzte internationale
Erfahrung und den Fundus an
Kontakten, um konkrete Projekte in die
Tat umzusetzen.
Sowohl im deutschsprachigen Raum
als auch weltweit wäre die Entwicklung
komplementärer Währungen heute
nicht auf dem Stand, auf dem sie
sich befindet.
Mit Margrit Kennedy verliert diese Bewegung
zwar eine der herausragenden
Kräfte, aber Impulse sind längst
in wegweisenden Projekten verwirklicht,
sodass der Geist ihrer Arbeit unverwüstliche
Früchte trägt. Mit „Geld
ohne Zinsen und Inflation“ legte sie
bereits 1991 ein leicht verständliches
Buch vor. Unzähligen Menschen
wurde damit der Blick in die Welt der
scheinbar undurchsichtigen Zusammenhänge
des Geldes geschärft. „Occupy
Money«, ihre letzte Buchveröffentlichung,
hat die sich weltweit
formierende Bewegung von Protestgruppen
mit grundlegendem Wissen
inspiriert. Wissen, das Instrumente an
die Hand gibt, mit denen aus Protesten
gegen vermeintlich fragwürdige
Mächte, eindeutige Forderungen für
Zukunftslösungen hervorgehen können.
Natürlich bemerkte Margrit Kennedy
zeitlebens, wie dick die Bretter
sind, die man bohren muss, um ein
derart fundamentales Umdenken vor
allem auf höchster politischer Ebene
zu erwirken. Ehrgeizige Ziele, dessen
war sie sich bewusst, erreicht man nur
durch vielschichtige Arbeit, maßgeblich
solche, die „von unten“ initiiert
wird. „Vielfalt“ war ohnehin ein Stichwort,
das sie stets bewegte. „Wir haben
bezüglich Kleidung, Autos und unendlich
vielen Dingen des Lebens eine
große Vielfalt an Angeboten. Zu nahezu
jeder einzelnen Vorliebe der Menschen
gibt es eine passende Auswahl.
Andererseits scheinen wir zu glauben,
dass eine einzige Geldform ausreicht,
all die Funktionen zu erfüllen,
die das Leben mit sich bringt!“ „Warum
lassen wir den Gedanken nicht zu,
dass es sinnvoll ist, ein unerschöpfliches
Reservoir an Zahlungsmitteln zu
gestalten, um die unterschiedlichen
Aufgaben zu meistern? Warum sollte
es nicht eigens eine Währung für Bildungsaufgaben
geben? Eine für die Altersvorsorge?
Oder eine, welche den
Erfordernissen der Nutzung unserer
Umwelt entspricht?“
In diesem Sinne argumentierte Margrit
Kennedy auf unzähligen Veranstaltungen,
auf denen sie als Referentin
oder Diskutantin eingeladen war. Sie
weigerte sich zu akzeptieren, dass es
„eine Wahrheit“ für alle Fragen gibt.
Immer war sie von der Totalität des
Seins überzeugt. Nichts, was wir tun,
aber auch nichts, was wir nicht tun,
bleibt ohne Folgen für das Ganze.
Sie konnte und wollte nicht verstehen,
warum die Logik eines Geldsystems,
das alles zu zerstören droht, was den
Menschen lieb und wertvoll ist, von einer
Mehrheit klaglos hingenommen zu
werden scheint.
Erinnerungen an Margrit Kennedy – Helmut Creutz
Erinnerungen
an meine ersten
Kontakte mit
den monetären
Realitäten –
und der Rolle
Margrit Kennedys
in diesem
Lebensabschnitt.
Der viel zu frühe Tod von Margrit Kennedy
hat bei mir viele Erinnerungen
wachgerufen. Vor allem bezogen auf
meine ersten Schritte in Sachen Zins
und Freiwirtschaft und damit jenem
völlig ungeplanten Lebensabschnitt,
der für mich, Ende der 1970er Jahre,
durch einen Zufall begann und wenige
Jahre später, durch die Begegnung
mit Margrit, äußerst wichtige Mut machende
Impulse erhalten hat.
Wie schon häufiger berichtet,
wurde ich Ende 1977, durch
die Zuschrift eines Lesers meines
Schultagebuchs „Haken krümmt
man beizeiten“, mit diesen geldbezogenen
Begriffen und Themen bekannt.
Jenes Buches, das vor allem durch die
Fernseh-Vorstellung in „Titel, Thesen,
Temperamente“ als Buch des Monats
viele Reaktionen in der Öffentlichkeit
auslöste, darunter auch diese Zuschrift
von Walter Michel aus Berlin, die mein
Leben verändern sollte.
Wie sich später herausstellte, handelte
es sich um einen selbstständigen Handwerksmeister,
der nach dem Krieg in der
DDR annahm, für das Thema Freiwirtschaft
und Gesell wieder öffentlich eintreten
zu können. Er hatte sich jedoch
geirrt und wurde wegen seiner Veröffentlichungen
von der damals noch vorherrschenden
sowjetischen Besatzungsmacht
verhaftet, erst zum Tode verurteilt
und dann zu lebenslänglicher Haft in der
berüchtigten Festung Bautzen „begnadigt“,
einer Strafe, von der er mehr als
zehn Jahre absitzen musste.
Was Walter Michel mir schrieb, war für
mich anfangs völlig unverständlich. Weder
den Namen Silvio Gesell noch den
Begriff „Freiwirtschaft“ (der mich immer
an eine sommerliche Gartenwirtschaft
erinnerte!) hatte ich je gehört. Und das
Gleiche galt auch für das beigelegte
kleine Buch eines Hans Kühn, „5000
Jahre Kapitalismus“, dem dann jedoch –
wenn auch stilistisch etwas aufgemotzt
– einige konkretere Angaben und Zahlen
zu entnehmen waren die mich neugierig
machten. Das besonders im Hinblick
auf die Auswirkungen exponentiell
wirkender Abläufe, mit denen er den
Zinseszins-Effekt beschrieb – einer Problematik,
die mir dadurch zum ersten
Mal deutlich wurde und für die ich vielleicht
auch nur deshalb offen war, weil
sich mir damals, Ende der 1970er Jahre
und angesichts der allgemeinen Wachstumseuphorie,
schon die Frage aufgedrängt
hatte, wie lange das eigentlich
noch weiter gehen sollte. Doch diese
von Hans Kühn gemachten Ausführungen
musste ich jedoch vor einer Antwort
an Walter Michel unbedingt überprüfen.
Das betraf vor allem die Gegensätzlichkeiten
von linearem und exponentiellem
Wachstum und deren Vergleiche
mit den natürlichen Wachstumsabläufen.
Bei denen die zeitlichen Abstände
zwischen den Verdopplungen bekanntlich
immer größer und schließlich „unendlich“
werden, wie wir aus unserer
eigenen Entwicklung ab 18-
20 Jahren
wissen. Im Gegensatz dazu, nahm ein
exponentielles Wachstum, mit gleich
bleibend langen Verdopplungs-Schritten,
ständig schneller zu – wie bei den
Geldanlagen durch Zins und Zinseszins
der Fall. Eine Entwicklung, die –
das hatte ich nach der Schrift von Hans
Kühn verinnerlicht – förmlich zu Explosionen
führen musste!
Erfahrungen zu den Zinsauswirkungen
in der Praxis
Zinsen waren mir – damals bereits 55
Jahre alt – bis dahin immer nur als eine
schöne Angelegenheit bekannt, über
deren Gutschrift auf dem Sparbuch
man sich am Jahresanfang immer freute.
Und bezogen auf die Hypotheken,
die ich für Bauwerke laufend aufnehmen
musste, blieb der Mix von Zinsen
und Tilgung in der Miete als Summe
häufig gleich. „Beweise“ für die zinsbedingten
Wachstums-Wirkungen in unserem
normalen Leben und vor allem
deren Brisanz, entdeckte ich dann erst
im Zusammenhang mit grafischen Aufzeichnungen
von Mietberechnungen
und deren Bestandteil-Verschiebungen
im Laufe der Jahre und Jahrzehnte.
Obwohl diese Berechnungen bei den
Wohnungsbaufinanzierungen eine
der Voraussetzungen für die staatlichen
zinsgünstigen Zuschüsse waren
und man sie im Vorhinein nachweisen
musste, waren mir diese Wechselwirkungen
nie aufgefallen. Und wirklich
überzeugend wurden sie für mich erst
dann, als ich sie beispielhaft nebeneinander
in Grafiken umsetzte. Das
vor allem bezogen auf jene Vorgänge
im Geld- und Kreditbereich, die mir
bislang als problemlos erschienen waren:
Wenn man zu viel Geld in der Tasche
hatte und vorerst nicht brauchte,
zahlte man es eben bei den Banken
ein, die es dann zwischenzeitlich weiter
verliehen. Und dass man dafür einen
– meist nur relativ geringen – Zins
erhielt, war eine kleine Belohnung für
diese Ersparnisbildung, die dann der
Kreditnehmer seinerseits jeweils an
die Bank zu zahlen hatte.
Auf Raiffeisens Spuren – Bericht von Pat Christ
Im deutschsprachigen Raum gründen sich immer mehr Sozialgenossenschaften
Ob Postdienst, Dorfladen, Arztpraxen,
Kinderbetreuungseinrichtungen oder
Busverbindungen – in ländlichen Räumen
dünnt die Infrastruktur zum Teil
dramatisch aus. Hierauf reagieren Sozialgenossenschaften.
Sie setzen sich
für demenzkranke Menschen ein oder
zielen, in Form von Seniorengenossenschaften,
auf ein kooperatives Altern
ab. Der Genossenschaftsgedanke
wächst stetig. So wurden in den vergangenen
acht Jahren in Deutschland rund
1.300 Genossenschaften gegründet.
Eine Sozialgenossenschaft ist eine
Versicherung auf Gegenseitigkeit:
Man gibt und hilft sich solidarisch.
Dahinter steckt die bereits
von Friedrich Wilhelm Raiffeisen forcierte
Idee, dass alle gemeinsam viel
mehr auf die Beine zu stellen vermögen
als ein Mensch alleine. Das gilt laut
Heike Walk vom Zentrum Technik und
Gesellschaft (ZTG) der TU Berlin auch
für ein so aktuelles Thema wie „Klimawandel“.
Als kollektive Zusammenschlüsse
haben Genossenschaften
den Analysen der Geschäftsführerin
des ZTG-Instituts für Protest- und Bewegungsforschung
zufolge vielfältige
Handlungsmöglichkeiten, um den Klimaschutz
in Städten voranzutreiben.
Viele Sozialgenossenschaften treten
als klassische Non-Profit-Organisationen
auf. Hier schließen sich Menschen
auf der Basis von Selbsthilfe oder ehrenamtlichen
Engagement kooperativ
zu zusammen. Daneben existieren aber
auch Sozialgenossenschaften, die zu
bezahlende Leistungen erbringen, die
zwar gesellschaftlich notwendig und
zentral für eine nachhaltige Entwicklung
sind, vom Markt aber nicht mehr
zur Verfügung gestellt werden.
Von palliativer Hilfe
bis zur Nahraumversorgung
Die Handlungsfelder von Sozialgenossenschaften
fächern sich demnach
stark auf. Allein im Gesundheits- und
Pflegesektor existiert heute eine breite
Angebotspalette, die vom Palliativbereich
über das Seniorenwohnen bis
hin zu Krankenhausnetzwerken reicht.
Selbst der Bereitschaftsdienst von
Ärzten kann sozialgenossenschaftlich
organisiert werden. Viele Genossenschaften
engagieren sich vor dem
Hintergrund des demographischen
Wandels auch dafür, die soziale Infrastruktur
vor Ort zu erhalten oder sie neu
zu schaffen. Dies betrifft die Kinderbetreuung
und die Jugendhilfe ebenso wie
die Themen „Altersgerechtes Wohnen“
und „Nahraumversorgung“.
Um die psychosoziale Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen kümmert
sich im italienischen Bruneck seit vielen
Jahren die Sozialgenossenschaft
EOS. Bereits 1995 eröffnete die Organisation
eine sozialpädagogische WG
für psychiatrisch auffällige Jugendliche.
Vier Jahre später startete sie in Bruneck
ein Projekt für ein Begleitetes Wohnen
von Heranwachsenden mit seelischen
Problemen. Ein zweites Projekt dieser
Art wurde 2001 in Bozen eröffnet. 2005
startete die von der Genossenschaft organisierte
Ambulante sozialpädagogische
Familienarbeit im Pustertal. Von
Jahr zu Jahr wuchs die Mitarbeiterzahl.
Heute liegt sie bei um die 80.
Auf, auf zum ersten Gefecht – Kommentar von Wilhelm Schmülling
Wer den Frieden will, darf nicht rüsten,
denn der Rüstung folgt der Krieg. Da
Deutschland keine Feinde hat, bräuchte
es auch keine Rüstung.
Wenn nur nicht die Rüstungslobby
mit dem Argument „Arbeitsplätze“
hausieren ginge,
natürlich nicht bei Ihnen, Sie wollen
sich doch keinen Panzer in den Vorgarten
stellen, sondern bei denen,
die das Geld dafür haben: bei den Regierenden.
Genau genommen, haben
auch die Regierungen dafür kein Geld,
das holen sie sich bei Ihnen. Nicht mit
einem bewaffneten Stoßtrupp, sondern
unbewaffnet mit Wahlunterlagen,
damit Sie ja die friedliebenden
Rüstungsbefürworter wählen. Sehr
freundlich reden sie über „Friedenssicherung“,
leben wir doch in einem
demokratischen Land, das verteidigt
werden müsse.
In Mali, Somalia oder Afghanistan und
vielen Ländern dieser Welt ist das anders.
Da herrschen Diktatur und Not.
Die Terroristen nützen das schamlos
aus, holen die jungen Männern aus
den Hütten, versprechen ihnen Brot
und Spiele, greifen erst ihre Landsleute,
dann auch uns an. Also müssen
wir uns bewaffnet verteidigen,
auch am Hindukusch. So hieß doch
der Schlachtruf zum ersten Gefecht in
Afghanistan. Jetzt schließt Ursula von
der Leyen Kampfeinsätze in Mali nicht
mehr aus.
Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen plädierte für ein stärkeres,
internationales Engagement in Afrika.
Die Truppenstärke in Mali soll von
180 auf 250 Soldaten erhöht werden.
Dort leben 15 Millionen Menschen, die
Hälfte davon – so Frau von der Leyen
– sind unter 15 Jahre alt. Können wir
sie bis zum Erwachsenenalter mit verstärkter
Entwicklungshilfe versorgen?
Wohl kaum. Also wird Deutschland
zunächst auch Waffen liefern. Da aber
Malis und andere
Afrikaner damit
nicht umgehen
können, müssen
deutsche Soldaten
vor Ort sein,
um den Umgang
mit der Waffe zu
lehren, auch um
zu töten. Wenn
Terroristen dabei
stören, wird
zurückgeschossen.
Einige Gutmenschen
schlagen doch tatsächlich
vor, wir sollten nur Brunnen bauen und
Ackerbau betreiben. Was für Narren!
Friedensverteidigung ohne Waffen? Ja,
das muss möglich sein, denn wie weit
haben uns bewaffnete „Landesverteidigungen“
gebracht? Kürzlich plakatierte
MISEREOR „Mut ist, Waffen mit
Worten zu bekämpfen.“ Sich darauf beschränken
bedeutet allerdings, den Zustand
des Elends zu festigen. Und hier
muss angesetzt werden: Gerechtigkeit
zur Grundlage der Politik machen!
Trachten wir zuerst nach der Gerechtigkeit
und alles andere wird uns zufallen.
Statt militärischer Verteidigung unhaltbarer
Zustände in der Welt – auch
bei uns – muss die soziale Frage gelöst
werden. Ihre Ursache muss erkannt
und beseitigt werden. In einer auf Profit
ausgerichteten Wirtschaftsordnung
ist das unmöglich. Eine auf Arbeitsertrag
fixierte Wirtschaftsordnung muss
eingerichtet werden.
Es gibt Hoffnung. Wir sind dabei, unsere
Einheit mit all unseren Mitmenschen
zu erkennen, so dass es bald
unmöglich sein wird, einander auszubeuten,
zu berauben oder gar zu
töten. Solange uns das nicht gelingt,
können wir nicht behaupten, in einer
zivilisierten Welt zu leben.
Auf, auf zum letzten Gefecht zur
Beseitigung systembedingter
Ungerechtigkeiten –
ohne Waffen!
Arbeit zwischen Verherrlichung und Entwertung – Günther Moewes
„In Deutschland waren noch nie so viele Menschen in Arbeit wie 2013“ tönt es aus den Medien. Und seit 1960 regelmäßig von allen Kanzlern: „Die Wende auf dem Arbeitsmarkt steht unmittelbar bevor.“ Es wird der Eindruck erweckt, die Arbeit nähme wieder zu. Die Realität sieht anders aus. Tatsächlich hat die Zahl der durchschnittlich geleisteten Jahresarbeitsstunden in Deutschland von 1960 bis 2012 um 35,4 auf 64,6 % abgenommen, d.h. um mehr als ein Drittel. Wenn sich die Zahl der Beschäftigten trotzdem erhöht hat, dann nur, weil diese Verringerung des tatsächlich erbrachten Arbeitsvolumens in Form von unbezahlter Arbeitszeitverkürzung auf drei Millionen Teilzeitbeschäftigte abgeladen wurde. Deren Zahl ist inzwischen höher als die der 2,95 Mio. Arbeitslosen. Diese 64,6 % der 1960 erbrachten Arbeitsstunden geben jedoch noch nicht den tatsächlichen Rückgang des Arbeitsvolumens wieder. Denn in ihr ist ja noch nicht die enorm gestiegene Arbeitslosigkeit enthalten. 2012 betrug die Arbeitslosigkeit in Deutschland 6,8 % (= 2,95 Mio.), 1960 ganze 1,3 % (0,27 Mio.). Würde man die 2012 insgesamt tatsächlich geleisteten Jahresarbeitsstunden mit auf die Arbeitslosen verteilen,
hätte jeder Erwerbsfähige pro Jahr 142 Std. weniger arbeiten müssen. Das so ermittelte heute erbrachte Arbeitsvolumen pro Erwerbsfähigen beträgt dann nur noch 59 % dessen von 1960, also über 40% weniger.
Steuerhinterziehung – Volkssport in unterschiedlichen Spielklassen – Dirk Löhr
Plädoyer für eine Staatsfinanzierung aus ökonomischen Renten
Alle tun es. Die Ikone Ulrich Hoeneß.
Der honorige CDU-Schatzmeister Helmut
Linssen. Die „moralische Instanz“
Alice Schwarzer. Der feinsinnige Kultur-
Staatssekretär André Schmitz aus
Berlin. Besonders pikant: Letzterer ist
Mitglied derjenigen Partei, die sich
als Vorreiter gegen kriminelle Steuerhinterzieher
sieht. Sein Parteifreund
Peer Steinbrück drohte seinerzeit damit,
die Kavallerie gegen die kleine
Schweiz ausrücken zu lassen.
Dabei nimmt sich jeder das, was
er kann. Steuerhinterziehung ist
ein Volkssport. Allerdings gibt es
verschiedene Ligen. Der eine trägt eben
internationale Spiele auf den Bahamas
aus, der andere bleibt in seinem Dorf
stecken – Kreisklasse, mit nicht ausgestellten
Handwerkerrechnungen.
Um das deutsche Steuersystem ranken
sich viele Mythen. 70–80 % der
weltweiten Steuerliteratur sollen sich
angeblich des Problemfalles Deutschland
annehmen. Das ist sicherlich maßlos
übertrieben. Doch selbst, wenn es
nur 15 % sind (Späth, o. J.) , ist dies
angesichts eines Anteils von 1,2 % an
der Weltbevölkerung doch schon eine
recht stolze Zahl. Für den „Vater Staat“
ist es dabei häufig das Kleinvieh, das
Mist macht. Konsequenz: Gerade Massenfälle
wie Dienstwagen, geldwerte
Vorteile, Dienstreisen etc. werden
so kompliziert und kleinlich geregelt,
dass kaum jemand mehr durchblickt.
Hinzu kommt ein Gerechtigkeitsfimmel
der deutschen Gerichte (der sich
dann irgendwann auch in den Verwaltungsanweisungen
niederschlägt).
Die Kosten des ganzen Theaters werden
zu einem großen Teil auf die Steuerpflichtigen
verlagert (auch in Gestalt
von Rechtsunsicherheiten).
Der erwähnte Gerechtigkeitsfimmel
der Gerichte tobt sich leider an der
vollkommen falschen Stelle aus. Das
zentrale Problem der Rentenökonomie
wird nämlich nicht angegangen. Am
besten erschließt sich dieses über das
sog. „Henry George-Theorem“ („Golden
Rule of Local Public Finance“), das
u.a. vom Nobelpreisträger und früheren
Weltbank-Chefökonomen Joseph
Stiglitz formalisiert wurde.
Das Henry George-Theorem (s. Abb.)
kann von links nach rechts und umgekehrt
interpretiert werden: Die öffentlichen
Güter (Infrastruktur, Sicherheit,
Bildung, Gesundheitseinrichtungen)
können unter bestimmten Bedingungen
vollständig aus den Bodenrenten
finanziert werden, wobei „Boden“ in
einem sehr weiten Sinne verstanden
wird (als alles, was der Mensch nicht
geschaffen hat, und sogar – wie bei
geistigen Eigentumsrechten – noch
darüber hinaus). Also: Man bräuchte
gar keine Steuern, wenn man den
Staat aus den ökonomischen Renten
finanzieren würde.



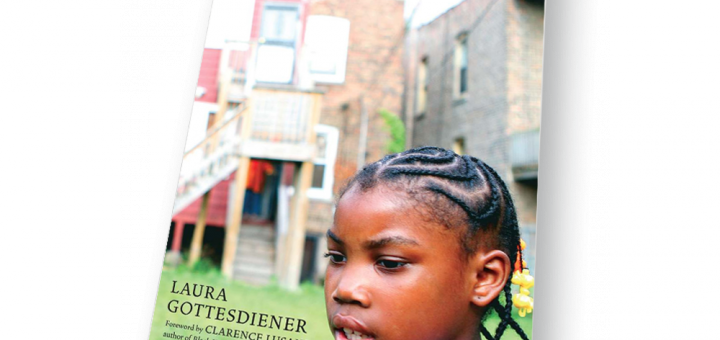




Aktuelle Kommentare