Kapitalismus ohne Rücksicht auf Verluste – Friedrich Müller-Reißmann
Kapitalismus ist die reale Perversion der idealen Marktwirtschaft Die Marktwirtschaft ist ein Wirtschaftssystem, das die (materiellen) Bedürfnisse aller Menschen auf effiziente,
nachhaltige Weise erfüllt und leistungslose Einkommen tendenziell unterbindet. Kapitalismus bewirkt systematisch das Gegenteil: Verschwendung begrenzter Ressourcen und Erzeugung
riesiger leistungsloser Einkommen zulasten
der arbeitenden Menschen. Kapitalismus
ist die große wirkungsvolle
Methode der Privilegierten, den Angriff
der Marktwirtschaft auf ihre Privilegien
ins Leere laufen zu lassen.
Hochglanzsystem
Kapitalismus
Die Reklame liefert tagtäglich den Beweis
für das Versagen des gegenwärtigen
Systems. Sie ist das allgegenwärtige
Armutszeugnis des Kapitalismus, gewissermaßen
ein Armutszeugnis auf Hochglanzpapier.
Ihre Botschaft zwischen
den Zeilen lautet: „Ein mündiger Verbraucher
wäre eine Katastrophe. Lasst euch manipulieren
und kauft, was ihr eigentlich nicht
braucht, und vor allem ständig mehr – sonst
funktioniert unsere Wirtschaft nicht!“. Kann
aber ein System auf die Dauer funktionieren,
das einen beispiellosen Wettbewerb
um die Gunst der Dummheit (Eitelkeit,
Verschwendungssucht, Angeberei
usw.) entfachen und ständig schüren
muss, um zu funktionieren?
Der Wettlauf der Titanic’s
Jeder ist verzweifelt bemüht, an der Spitze
mitzuhalten. Wer nicht anderen voraus
ist, hat schon verloren. Ein Wettlauf,
ohne das Ziel zu kennen. Niemand fragt
nach der Richtung, niemand stellt sich
die Frage, ob am Ende ein Ziel winkt, für
das sich die ganze Anstrengung lohnt.
Noch schlimmer: ein Ende dieses gigantischen
Wettlaufs ist gar nicht vorstellbar.
Der Kapitän und die Offiziere feuern
die Mannschaft an, das Letzte zu geben.
Auch die Passagiere, vor allem die weniger
privilegierten unter ihnen, werden
aufgerufen, „umzudenken“, Abstriche
an ihren gewohnten Rechten hinzunehmen
und alles in den Dienst des Wettlaufs
zu stellen…
„Und glaubt ja nicht, denen auf den anderen
Schiffen ginge es besser. Auch die
bringen schmerzhafte Opfer, um nicht
abgehängt zu werden“. Warum dieser
Wahnsinn? Eine mögliche Antwort: Niemand
weiß, wie man sich von diesem
Wettlauf abkoppelt, ohne dass man
dann auf einer langsam verrottenden Titanic
einsam durch den Ozean dümpelt.
Also schlicht und einfach Mangel an
machbaren und attraktiven Alternativen
zum bedingungslosen Wettlauf?
Doch das kann nicht die ganze Antwort
sein. Denn sie erklärt nicht, warum die
Suche nach Alternativen von den Kapitänen
und Offizieren immer so schnell
als Phantasterei, Spinnerei, Wunschdenken
usw. abgetan oder sogar als gefährliche
Systemveränderung diffamiert
wird. Nein, die Erklärung ist meines Erachtens
darin zu suchen, dass in ihren
Köpfen eine ideologische Verklärung
des Wettlaufs als Garant grenzenlosen
Fortschritts existiert, wohlgemerkt,
genau dieses gigantischen Wettlaufs,
nicht des Wettbewerbs als stimulierendem
Prinzips der Evolution, sonst könnte
man ja auch seine Kraft auf den Wettbewerb
der Ideen konzentrieren, wie
das Leben auf dem Schiff am schönsten
und gerechtesten für alle Schiffsbewohner
zu gestalten ist. Doch man vertraut
lieber darauf, dass man sich diesen
schwierigen Fragen nach Lebensqualität
und Gerechtigkeit nicht stellen muss,
wenn man nur im großen Wettlauf die
anderen Schiffe hinter sich lässt.
Ideologische Dogmen schweben nicht
im realitätsleeren Raum. Im Grunde wissen
die Kapitäne, dass sie selbst nur
dann überproportional vom Wettkampf
profitieren, wenn sie vorn liegen und
das heißt: Wer auf den hinteren Plätzen
liegt, zahlt überproportional. Eigentlich
wird das ziemlich offen ausgesprochen.
„Wenn wir unseren Wohlstand halten
wollen, müssen wir im internationalen
Wettbewerb die Nase vorn behalten.“
Man sagt zwar: Vom freien Welthandel
profitieren alle, aber man weiß: So gut
wie es uns geht, kann es uns nur gehen,
wenn es den anderen nicht so gut geht.
Das ist die Ideologie hinter der Ideologie
unseres Wirtschaftssystem: Wir können
uns das Glück gar nicht mehr anders
vorstellen als das Glück von Siegern.
Und Sieger siegen nun mal auf Kosten
der Verlierer.




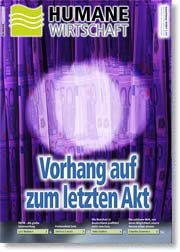



Aktuelle Kommentare