Ratschläge eines Gärtners – Stefan Nold
In dem Film von Hal Ashby „Welcome
Mr. Chance“ spielt Peter Sellers einen
Gärtner, der weder lesen noch schreiben
kann. Durch Zufall wird er für den
amerikanischen Präsidenten zum wichtigsten
Berater. Seine mit tiefem Ernst
vorgetragenen Sprüche wie „Auf den
Frühling folgt der Sommer, dann der
Herbst und der Winter“ werden allseits
als Quelle tiefer Weisheit bewundert.
Einige von solchen Sprüchen habe ich
auch auf Lager:
Kluge Köpfe sind Kapital
Unser wirtschaftliches Denken klebt
an materiellen Dingen. Was in den Köpfen
steckt, taucht in keiner Bilanz auf.
Nach dem Krieg hat das in den Köpfen
vorhandene Know-How den deutschen
Wirtschaftswunder-Motor angetrieben.
Damals hatte Portugal Gold, Deutschland
ein kaputtes Land. Nach unserer
Bilanzierungsmethode hätte Portugal
erfolgreicher sein müssen, denn wir
bilanzieren nur Gold, Immobilien, Kapital.
Dabei ist es das Know-How, das
auf lange Sicht den Unterschied macht.
Wenn ein Lehrer für tausend Euro Unterrichtsmaterial
kauft, damit seine Schüler
den Stoff durch eigene Anschauung
verstehen, dann ist das Verbrauch und
damit pfui. Er hätte auch Süßigkeiten
kaufen können. Wenn man für hundert
Millionen eine Straße baut, erscheint
sie für exakt diesen Betrag als Aktivposten
in der Bilanz.



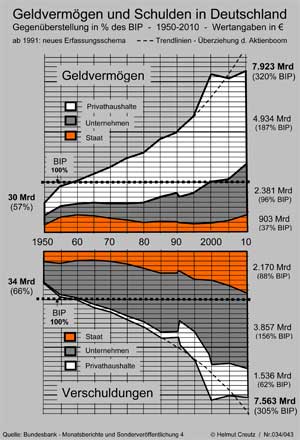



Aktuelle Kommentare