Steuer als Alternative zur Bargeldabschaffung – JP Koning – Deutsch von A. Bangemann
Banknoten von hohem Nominalwert sind in internationalen Fachkreisen in der Diskussion.
Strittig ist eine wichtige Eigenschaft des Bargelds, die sowohl positiv, wie negativ bewertet werden kann: Die Anonymität beim Bezahlen. Einiges spricht dafür, eine Trennung innerhalb der Geldpolitik vorzunehmen, die im Ergebnis sinnvolle Maßnahmen in Bezug auf die Anonymität von Bargeldzahlungen zulässt, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten. – - –
JP Koning plädiert für eine Steuer auf Bargeld, anstelle der Abschaffung.- – -
Einleitung der Redaktion – - –
Ken Rogoff fordert bekanntlich ein Verbot von Banknoten mit hohem Wert, um gegen Steuerhinterziehung und Kriminalität vorzugehen. Aber anstatt Geldscheine bestimmter Größen komplett zu verbieten, könnte man auch einen marktbezogenen Ansatz verfolgen, indem man eine Steuer einführen würde. Neben weiteren Vorteilen gäbe eine Steuer den Menschen Flexibilität. Es bliebe ihnen überlassen, bezüglich der Einschränkung der Verwendung von Geldscheinen den für sie billigsten Weg zu finden. Ein vergleichbares Verfahren hat man auch gewählt, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Warum also diesen steuerlichen Weg nicht auch bei Banknoten gehen? – - –
Mein Beitrag für das „Sound Money Project“ hinsichtlich der Einführung von Preisen für den Vorteil finanzieller Anonymität befasste sich mit dieser Idee. Die Eigenschaft der Anonymität von Banknoten ist sowohl „gut“ als auch „schlecht“. Menschen haben eine legitime Nachfrage nach einem finanziellen Schutzraum; einer sicheren Zone, in der weder Freunde, Familie, Regierung noch andere Dritte sehen können, was sie kaufen oder verkaufen. Heutzutage ist Bargeld der einzige Weg, dies zu gewährleisten. – - –
Jedoch kann dieser Schutzraum für Steuerhinterziehung missbraucht werden. Die daraus resultierende Finanzierungslücke zwingt die ehrliche Steuerzahlermehrheit dazu, einen höheren als ihren gerechten Anteil für staatliche Dienstleistungen zu bezahlen. Dieser Zustand ist nicht hinnehmbar. – - –
Die Financial Privacy Tax – - –
Eine Möglichkeit, dieser Ungerechtigkeit zu begegnen, besteht darin, den Preis der Banknotennutzung so anzuheben, dass damit die Kosten des Verlusts durch Steuerhinterzieher kompensiert werden. Mit einer Steuer auf Banknoten, nennen wir es eine „Financial Privacy Tax“ , lässt sich das erreichen. Sie internalisiert externe Kosten, bzw. den finanziellen Schaden, der anderen zugefügt wird. – - –
Interessanterweise gibt es diese Steuer bereits. Für jede von ihr ausgegebene Banknote erhält eine Zentralbank normalerweise ein risikoloses, verzinsliches Wertpapier in ihren Bestand. In einem freien Markt würde dieser so von der Zentralbank eingenommene Zins den Inhabern von Banknoten zugutekommen, zum Beispiel durch die Einführung von Lotterien zugunsten von Seriennummern auf den Banknoten. Anstatt die vereinnahmten Zinsen umzuverteilen, behält die Zentralbank sie jedoch zurück. Der Betrag, den sie einbehält, stellt gewissermaßen die Financial Privacy Tax dar. – - –
In Kanada zum Beispiel beträgt der Tagesgeldsatz (overnight interest rate) derzeit 1,25 %. Da der Zins einer Banknote bei 0% liegt, behält die Bank of Canada $ 1,25 Zinszahlungen für jede 100-Dollar-Note ein. Auf diese Weise wird ein banknotennutzender Kanadier effektiv mit 1,25 C$ pro verwendetem 100-Dollarschein besteuert. Wer die Steuerpflicht vermeiden will, zahlt die Banknote auf ein Bankkonto und spart dadurch 1,25 % pro Jahr. Aber sobald man das tut, gibt man seine finanzielle Privatsphäre auf. – - –
Zinsen als Instrument der Geldpolitik – - –
Gegenwärtig sind derlei Steuern auf Banknoten nicht bewusst als Beitrag zum Schutz der Anonymität beim Bezahlen gedacht. Damit meine ich, es ist nicht so, dass Zentralbanker sich an einen Konferenztisch gesetzt hätten und intensiv über die Kosten und Vorteile der Anonymität nachgedacht hätten, um die Höhe der Steuer bestmöglich auszutarieren. Sie ergab sich vielmehr zufällig. Historisch betrachtet nehmen Notenbanker einfach an, dass man für Banknoten niemals einen anderen Zins als 0 % erzielen kann. (Genau justierbare Zinssätze für Geldscheine, sowohl positive als auch negative, sind tatsächlich ziemlich einfach zu verwirklichen, wie ich zeigen werde). Das bedeutet, dass die Privacy Tax stets so hoch ist wie der zuletzt festgelegte Tagesgeldsatz. – - –
Der Tagesgeldsatz ist indessen Ausdruck eines völlig anderen Denkprozesses: der Geldpolitik. Die Zentralbanker pendeln den Tagesgeldsatz nach oben oder unten, um das von ihnen gewählte Inflationsziel zu erreichen. Das Problem dabei ist, dass zwei separate Entscheidungen zusammengeworfen werden. Die Höhe, in der die Zentralbank ihre Financial Privacy Tax festsetzt, ist zu einem schlecht durchdachten Nebenprodukt ihrer gewählten makroökonomischen Politik geworden. – - –
Hier ein Beispiel für dieses Durcheinander: Wenn die Bank of Canada beschließt, die Geldpolitik morgen durch eine Erhöhung ihres Zinssatzes von 1,25 % auf 1,5 % zu straffen, hat sie gleichzeitig eine davon völlig abgetrennte Entscheidung getroffen, nämlich die Privacy Tax auf Banknoten um 0,25 % zu erhöhen. Aber während die geldpolitische Entscheidung von einer Fülle von Daten und Berechnungen geleitet wird, ist die Erhöhung der Privacy Tax rein willkürlich – kein logischer Gedanke hat eine Erhöhung gerechtfertigt. Man hat vollendete Tatsachen geschaffen. – - –
Betrachten wir es noch aus einem anderen Blickwinkel. Nehmen wir an, dass die Bank of Canada festgestellt hat, dass es angemessen wäre, die Financial Privacy Tax um 0,25 % zu erhöhen. Mit seinen derzeitigen Werkzeugen kann sie dies nur erreichen, indem sie den Tagesgeldsatz um 0,25 % erhöht. Aber diese Straffung der Geldpolitik könnte möglicherweise die gesamte Wirtschaft ins Trudeln bringen, um ein völlig anderes politisches Ziel zu erreichen, nämlich die angemessene Besteuerung der Privatsphäre. – - –
Es gibt keinen guten Grund dafür, die beiden Entscheidungen nicht voneinander zu trennen. Das Instrument, das es den Zentralbankern ermöglichen würde, dies zu tun, ist die Befähigung, positive und negative Zinssätze für Banknoten festzusetzen. Ich habe weiter oben von Lotterien der Seriennummern gesprochen, mit deren Hilfe positive Zinsen ausbezahlt werden könnten. Im Weiteren werde ich eine Möglichkeit erörtern, wie negative Zinsen bezahlt werden können. Um zu erkennen, wie diese Instrumente geldpolitische Entscheidungen erfolgreich von jenen der Privacy Tax trennen könnten, kehren wir zu unserem vorherigen Beispiel zurück. Sollte die Bank of Canada den Tagesgeldsatz aus geldpolitischen Überlegungen von 1,25 % auf 1,5 % erhöhen, will aber die Financial Privacy Tax nicht ändern, dann könnte sie gleichzeitig den Zinssatz für Banknoten von 0% auf 0,25 % erhöhen. Die ursprüngliche Steuer von 1,25 % bliebe dadurch für den Geldscheinbesitzer intakt. Er erhält die Erhöhung der Steuer durch die 0,25 % Zinsen auf seine Scheine ersetzt. – - –
Umgekehrt würden diese Instrumente es ermöglichen, die Privacy Tax zu erhöhen oder zu senken, ohne eine potenziell schädliche Änderung der Geldpolitik auszulösen. In unserem Beispiel würde die Bank of Canada, um die Privacy Tax von 1,25 % auf 1,5 % zu erhöhen, bei gleichzeitigem konstant Halten des Tagesgeldsatzes, den Zinssatz für Banknoten von 0 % auf ‑0,25 % ändern. Dadurch werden Besitzer von Banknoten mit 1,5 % pro Jahr besteuert, wovon 1,25 % auf den entgangenen Tagesgeldsatz entfallen und der andere Teil der 0,25 %-ige Negativzinssatz ist. Dies würde ohne eine Verschärfung oder Lockerung der Geldpolitik erreicht. – - –
Damit hätten wir Grundlegendes erreicht: Geldpolitische Entscheidungen wären von jenen zur Privacy Tax getrennt. Der Vorteil, diese beiden Denkprozesse aufteilen zu können, besteht darin, dass es fortan möglich ist, genauestens darüber nachzudenken, welches der richtige Steuersatz für die Privatsphäre sein sollte. – - –
weitere Details online…
JP Koning plädiert für eine Steuer auf Bargeld, anstelle der Abschaffung.- – -
Einleitung der Redaktion – - –
Ken Rogoff fordert bekanntlich ein Verbot von Banknoten mit hohem Wert, um gegen Steuerhinterziehung und Kriminalität vorzugehen. Aber anstatt Geldscheine bestimmter Größen komplett zu verbieten, könnte man auch einen marktbezogenen Ansatz verfolgen, indem man eine Steuer einführen würde. Neben weiteren Vorteilen gäbe eine Steuer den Menschen Flexibilität. Es bliebe ihnen überlassen, bezüglich der Einschränkung der Verwendung von Geldscheinen den für sie billigsten Weg zu finden. Ein vergleichbares Verfahren hat man auch gewählt, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Warum also diesen steuerlichen Weg nicht auch bei Banknoten gehen? – - –
Mein Beitrag für das „Sound Money Project“ hinsichtlich der Einführung von Preisen für den Vorteil finanzieller Anonymität befasste sich mit dieser Idee. Die Eigenschaft der Anonymität von Banknoten ist sowohl „gut“ als auch „schlecht“. Menschen haben eine legitime Nachfrage nach einem finanziellen Schutzraum; einer sicheren Zone, in der weder Freunde, Familie, Regierung noch andere Dritte sehen können, was sie kaufen oder verkaufen. Heutzutage ist Bargeld der einzige Weg, dies zu gewährleisten. – - –
Jedoch kann dieser Schutzraum für Steuerhinterziehung missbraucht werden. Die daraus resultierende Finanzierungslücke zwingt die ehrliche Steuerzahlermehrheit dazu, einen höheren als ihren gerechten Anteil für staatliche Dienstleistungen zu bezahlen. Dieser Zustand ist nicht hinnehmbar. – - –
Die Financial Privacy Tax – - –
Eine Möglichkeit, dieser Ungerechtigkeit zu begegnen, besteht darin, den Preis der Banknotennutzung so anzuheben, dass damit die Kosten des Verlusts durch Steuerhinterzieher kompensiert werden. Mit einer Steuer auf Banknoten, nennen wir es eine „Financial Privacy Tax“ , lässt sich das erreichen. Sie internalisiert externe Kosten, bzw. den finanziellen Schaden, der anderen zugefügt wird. – - –
Interessanterweise gibt es diese Steuer bereits. Für jede von ihr ausgegebene Banknote erhält eine Zentralbank normalerweise ein risikoloses, verzinsliches Wertpapier in ihren Bestand. In einem freien Markt würde dieser so von der Zentralbank eingenommene Zins den Inhabern von Banknoten zugutekommen, zum Beispiel durch die Einführung von Lotterien zugunsten von Seriennummern auf den Banknoten. Anstatt die vereinnahmten Zinsen umzuverteilen, behält die Zentralbank sie jedoch zurück. Der Betrag, den sie einbehält, stellt gewissermaßen die Financial Privacy Tax dar. – - –
In Kanada zum Beispiel beträgt der Tagesgeldsatz (overnight interest rate) derzeit 1,25 %. Da der Zins einer Banknote bei 0% liegt, behält die Bank of Canada $ 1,25 Zinszahlungen für jede 100-Dollar-Note ein. Auf diese Weise wird ein banknotennutzender Kanadier effektiv mit 1,25 C$ pro verwendetem 100-Dollarschein besteuert. Wer die Steuerpflicht vermeiden will, zahlt die Banknote auf ein Bankkonto und spart dadurch 1,25 % pro Jahr. Aber sobald man das tut, gibt man seine finanzielle Privatsphäre auf. – - –
Zinsen als Instrument der Geldpolitik – - –
Gegenwärtig sind derlei Steuern auf Banknoten nicht bewusst als Beitrag zum Schutz der Anonymität beim Bezahlen gedacht. Damit meine ich, es ist nicht so, dass Zentralbanker sich an einen Konferenztisch gesetzt hätten und intensiv über die Kosten und Vorteile der Anonymität nachgedacht hätten, um die Höhe der Steuer bestmöglich auszutarieren. Sie ergab sich vielmehr zufällig. Historisch betrachtet nehmen Notenbanker einfach an, dass man für Banknoten niemals einen anderen Zins als 0 % erzielen kann. (Genau justierbare Zinssätze für Geldscheine, sowohl positive als auch negative, sind tatsächlich ziemlich einfach zu verwirklichen, wie ich zeigen werde). Das bedeutet, dass die Privacy Tax stets so hoch ist wie der zuletzt festgelegte Tagesgeldsatz. – - –
Der Tagesgeldsatz ist indessen Ausdruck eines völlig anderen Denkprozesses: der Geldpolitik. Die Zentralbanker pendeln den Tagesgeldsatz nach oben oder unten, um das von ihnen gewählte Inflationsziel zu erreichen. Das Problem dabei ist, dass zwei separate Entscheidungen zusammengeworfen werden. Die Höhe, in der die Zentralbank ihre Financial Privacy Tax festsetzt, ist zu einem schlecht durchdachten Nebenprodukt ihrer gewählten makroökonomischen Politik geworden. – - –
Hier ein Beispiel für dieses Durcheinander: Wenn die Bank of Canada beschließt, die Geldpolitik morgen durch eine Erhöhung ihres Zinssatzes von 1,25 % auf 1,5 % zu straffen, hat sie gleichzeitig eine davon völlig abgetrennte Entscheidung getroffen, nämlich die Privacy Tax auf Banknoten um 0,25 % zu erhöhen. Aber während die geldpolitische Entscheidung von einer Fülle von Daten und Berechnungen geleitet wird, ist die Erhöhung der Privacy Tax rein willkürlich – kein logischer Gedanke hat eine Erhöhung gerechtfertigt. Man hat vollendete Tatsachen geschaffen. – - –
Betrachten wir es noch aus einem anderen Blickwinkel. Nehmen wir an, dass die Bank of Canada festgestellt hat, dass es angemessen wäre, die Financial Privacy Tax um 0,25 % zu erhöhen. Mit seinen derzeitigen Werkzeugen kann sie dies nur erreichen, indem sie den Tagesgeldsatz um 0,25 % erhöht. Aber diese Straffung der Geldpolitik könnte möglicherweise die gesamte Wirtschaft ins Trudeln bringen, um ein völlig anderes politisches Ziel zu erreichen, nämlich die angemessene Besteuerung der Privatsphäre. – - –
Es gibt keinen guten Grund dafür, die beiden Entscheidungen nicht voneinander zu trennen. Das Instrument, das es den Zentralbankern ermöglichen würde, dies zu tun, ist die Befähigung, positive und negative Zinssätze für Banknoten festzusetzen. Ich habe weiter oben von Lotterien der Seriennummern gesprochen, mit deren Hilfe positive Zinsen ausbezahlt werden könnten. Im Weiteren werde ich eine Möglichkeit erörtern, wie negative Zinsen bezahlt werden können. Um zu erkennen, wie diese Instrumente geldpolitische Entscheidungen erfolgreich von jenen der Privacy Tax trennen könnten, kehren wir zu unserem vorherigen Beispiel zurück. Sollte die Bank of Canada den Tagesgeldsatz aus geldpolitischen Überlegungen von 1,25 % auf 1,5 % erhöhen, will aber die Financial Privacy Tax nicht ändern, dann könnte sie gleichzeitig den Zinssatz für Banknoten von 0% auf 0,25 % erhöhen. Die ursprüngliche Steuer von 1,25 % bliebe dadurch für den Geldscheinbesitzer intakt. Er erhält die Erhöhung der Steuer durch die 0,25 % Zinsen auf seine Scheine ersetzt. – - –
Umgekehrt würden diese Instrumente es ermöglichen, die Privacy Tax zu erhöhen oder zu senken, ohne eine potenziell schädliche Änderung der Geldpolitik auszulösen. In unserem Beispiel würde die Bank of Canada, um die Privacy Tax von 1,25 % auf 1,5 % zu erhöhen, bei gleichzeitigem konstant Halten des Tagesgeldsatzes, den Zinssatz für Banknoten von 0 % auf ‑0,25 % ändern. Dadurch werden Besitzer von Banknoten mit 1,5 % pro Jahr besteuert, wovon 1,25 % auf den entgangenen Tagesgeldsatz entfallen und der andere Teil der 0,25 %-ige Negativzinssatz ist. Dies würde ohne eine Verschärfung oder Lockerung der Geldpolitik erreicht. – - –
Damit hätten wir Grundlegendes erreicht: Geldpolitische Entscheidungen wären von jenen zur Privacy Tax getrennt. Der Vorteil, diese beiden Denkprozesse aufteilen zu können, besteht darin, dass es fortan möglich ist, genauestens darüber nachzudenken, welches der richtige Steuersatz für die Privatsphäre sein sollte. – - –
weitere Details online…


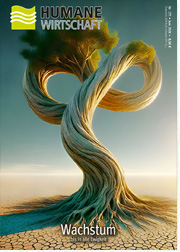

Aktuelle Kommentare