Zu Helmut Creutz’ Beitrag:
„Das Geld für die Zinsen fehlt in der Wirtschaft“
HUMANE WIRTSCHAFT 05/2014
Es ist gut, dass sich Helmut Creutz dieses Themas angenommen hat, da es doch ein wichtiges Kapitel von Wachstumszwang und Zinswirkung darstellt.
Das Beispiel mit den Metallstücken auf einer Insel ist natürlich sehr platt und betrifft vordergründig nur Bargeld. Dieses Bargeld wurde aber – und das ist der entscheidende Punkt – gegen eine Schuldverschreibung an die Bewohner ausgegeben. Der „Fremde“ wird jedoch keinesfalls am Ende des Jahres alles Geld einziehen und denjenigen, der die tatsächlich fehlenden Zinsen nicht zurückzahlen kann, in den Schuldenturm werfen lassen, nein: Er wird selbstverständlich diesem einen neuen Kredit geben, mit dem er a) seine Schuld (das fehlende Zins-Geld) zurückzahlen kann und b) weiterhin und in noch höherem Masse verpflichtet wird, seine Leistung zu steigern – zugunsten des Kapitalgebers natürlich. Außerdem werden auch alle anderen wieder einen Kredit erhalten, da sie a) den vorigen zurückzahlen konnten, also gute Schuldner sind und b) weiterhin Geld für ihr Wirtschaften brauchen. Es geschieht also das gleiche auf der fiktiven Insel, wie in Realität: Die Kredite werden ausgeweitet, die Geldmenge steigt an! Natürlich ist auch in dieser zweiten Runde das Geld für die Zinskosten nicht ausgegeben worden. Da die Kredithöhe gestiegen ist, ist auch der Fehlbetrag nun höher. Dieser ist als zusätzlicher Kredit nun ins System geschleust worden. Ich will dies einmal als Zins-Kredit bezeichnen, ein Phänomen, das weitläufig bekannt ist bei Entwicklungsländern, jedoch immer als individuelles Problem verstanden wird, statt als systemisches Phänomen, dass zwangsläufig da sein muss.
Dass dies mit einer Leistungssteigerung ausgeglichen werden kann ist aber leider nicht ganz richtig. Die Leistungssteigerung ist nur dafür maßgebend, wer das knappe Geld erhält und wer den schwarzen Peter. Wenn alle ihre Leistung steigern, müssten die Preise fallen, da alle um das gleiche Geld konkurrieren müssen. Es gibt nun drei Wege wie diese Fehlkonstruktion korrigiert werden kann:
Der von Helmut Creutz genannte: Der Zins zwingt alle Volkswirtschaften zum Wachstum, wenn soziale Spannungen nicht unerträglich werden sollen. Die Kreditausweitung ermöglicht den alten Schuldnern das zusätzliche Geld für die Zinszahlungen von den neuen Schuldnern zu erhalten. Die Höhe der Zins-Kredite wird so aber immer weiter ansteigen, exponentiell gegen die „Real-Kredite“, wenn nicht andere Faktoren noch korrigierend eingreifen.
Durch Bankrott und Schuldenerlass werden diese falschen Schulden periodisch aus dem System entfernt. Da die Kreditgeber ja durch Zinszahlungen zumeist schon ein mehrfaches an Kapital ausgezahlt erhalten haben, ist der volkswirtschaftliche Effekt entgegen der landläufigen Meinung meist positiv.
Durch die zusätzliche Schaffung des notwendigen Zins-Geldes, das dann durch einen „Schenkungsvorgang“ in die Wirtschaft eingeschleust wird, z. B. als Grundeinkommens-Anteil oder als direkte Staatsausgaben. Dies setzt die Zinsfunktion nicht außer Kraft, kompensiert aber bei richtiger „Dosierung“ deren Effekt und weitet aber die Geldmenge genau gleich aus. Die Zins-Schuldner sind nun nicht mehr nötig.
Es ist eben doch so, dass wir auf einer Insel leben, einfach auf einer riesigen, mit einem Geldsystem, das alle diese Effekte elegant verwischt und verschleiert.
Jens Martignoni, Zürich (Schweiz)
Direkte Antwort auf diesen Leserbrief:
„Da weitgehend gleicher Auffassung, hat mich der Leserbrief von Jens Martignoni gefreut! – Das ‚fehlende Inselgeld für die Zinsen‘ wird heute – da Zinsen in alle Preise eingehen – bei den Verbrauchern abkassiert und schließt über die Kreditvergaben der Banken wieder die Lücke im Geldkreislauf. Allerdings muss man zwischen den Kreisläufen Banken-Zentralbank und Banken-Publikum strikt unterscheiden, wie schon in meinem Artikel dargelegt: Nur bei dem erstgenannten Kreislauf handelt es sich um Geld, bei dem zweiten nur um Kreditvergaben aus den Ersparnissen mit Geld, die sich bekanntlich schon seit Jahrzehnten vor allem durch die Zinszahlungen vermehren.
Wenn Jens Martignoni schreibt, ‚dass wir auf einer Insel leben… mit einem Geldsystem dass alle diese Effekte elegant verwischt und verschleiert‘, ist er jedoch vielleicht etwas zu optimistisch. Denn wohin uns diese Effekte führen, zeigen nicht nur die immer rascher wachsenden weltweiten Diskrepanzen zwischen Arm und Reich, sondern ebenso die zunehmenden Krisen in Banken und Volkswirtschaften… nicht zuletzt bis hin zu jenen sich derzeit sogar wieder einmal auf schaukelnden Kriegsgefahren.“
Helmut Creutz, Aachen
Zum Editorial, HUMANE WIRTSCHAFT 05/2014
Durch Ihr (gutes) Editorial, Zitat: „Das als dienendes Tauschmittel gedachte Geld…“, ist mir die Gelddefinition von Götz Werner in den Sinn gekommen:
„Für viele Zeitgenossen ist noch zu wenig deutlich, worum es sich beim Geld eigentlich handelt: um eine Weltbuchhaltung von Leistungs- und weiteren sozialen Beziehungen der Menschen. Sie hilft, Probleme zu sehen und zu lösen. Die Hauptaufgabe des Geldes liegt in der Abrechnung von Güter- und Dienstleistungsströmen (kurz: Leistungsströmen) und macht uns bewusst, welche Menschen in welcher Weise an dem Füreinander der Leistungserstellung beteiligt sind. Sekundärfunktionen wie Wertaufbewahrung oder Wertmessung kann das Geld nur erfüllen, wenn es zuvor diese Primäraufgabe erfüllt.“
Aus DIE ZEIT online:
http://www.zeit.de/online/2007/38/besser-wirtschaften
Rob Maris
Wider dem Naturrecht
Auch in Ausgabe 5–2014 sind Editorial und Kommentar wieder hilfreich, um die Miseren dieser Welt zu verstehen.
Das Editorial weist, neben dem Sicherheit gebenden natürlichen Überfluss, auch auf das im Überfluss vorhandene Geld hin, das aber im kapitalistischen System das Gegenteil der Sicherheit bewirkt, weil es sich leistungslos aus sich selbst vermehrt und so Reiche reicher und Arme zahlreicher macht.
Schon Aristoteles meinte: „Das Geld ist für den Tausch entstanden, der Zins aber weist ihm die Bestimmung an, sich durch sich selbst zu vermehren. Daher widerstreitet diese Erwerbsweise unter allen am weitesten dem Naturrecht.“
Und weil die Vermehrung des Geldes nicht vom Himmel fällt, zahlen es hauptsächlich die Nettozahler des Systems über Preise und Steuern, wie es schon bei Bert Brecht heißt: „Armer Mann und reicher Mann, standen da und sah’n sich an. Und der Arme sagte bleich: wär’ ich nicht arm, wärst du nicht reich.“
Dazu kommt noch, dass die zu Gesells Zeit praktizierte Geldhortung im Tresor, (um fallende Zinsen durch Verknappung wieder hochzutreiben), der um vieles lukrativeren Spekulation gewichen ist. So brachte die Globalisierung Friedman’scher Prägung die Deregulierung (Reagan und Thatcher) samt der Zulassung toxischer Papiere, was den Siegeszug der Habgier einleitete – und so den Niedergang des menschengerechten Wirtschaftens. Der unaufhaltsame Kollaps, der die Gesellsche Warnung jetzt wahr zu machen droht: „Unser Geld bedingt den Kapitalismus, den Zins, die Massenarmut, die Revolte und schließlich den Bürgerkrieg, der zur Barbarei zurückführt.“
Bleibt die Frage: Was kann der „Dritte Weg“ noch bewirken?
Edgar Betz
Sehr geehrter Herr Bangemann,
Sie haben in Ihrem Vorwort den damals realen Sowjetkommunismus mit dem Marxismus gleichgesetzt, was, soweit ich Marx verstanden habe, in dieser Form nicht stimmt. Denn Marx ging es in erster Linie um das Gesamtwohl des Menschen und nicht um Strategien, wie einen Massenkonsum, der reine materielle Bedürfnisse der Menschen erfüllt. Er wollte in erster Linie die Verwirklichung eines humanen Menschseins, dass nicht von Äußerlichkeiten entwertet werden kann.
Das Buch von Erich Fromm: Das Menschenbild bei Marx ist dafür ein guter Beweis.
Karin Koehler
Knappheit
Ihre Zeitschrift begeistert mich von Artikel zu Artikel immer mehr.
Als gelernte DDR Bürgerin hatten wir oft aus der Knappheit eine Tugend zu machen. Wir aber auch begriffen, dass man sich nicht alle Tage Neues anschaffen kann und deshalb wurden hochwertige Konsumgüter so produziert, dass sie eine lange Haltbarkeitsdauer hatten. (Keine wesentlichen Schwachstellen, um den Absatz zu forcieren). Wir hatten keine Fülle unterschiedlicher Schulsysteme, aber alle Kinder erhielten eine solide und ordentliche Ausbildung. Und für Kriege jedweder Art setzte sich weder die Regierung noch das Volk ein. Ich denke, wir wussten schon damals, dass es keine Ersatzerde gibt, auf die wir flüchten können.
Doch das ist alles schon 25 Jahre Geschichte. Man redet von Nachhaltigkeit bei den Bäumen, zum Fällen braucht man eine halbe Stunde, zum Wachsen brauchen sie 100 Jahre. Wo ist da die Nachhaltigkeit?
In diesen vergangenen 25 Jahren wurde die Erde (die es nur ein einziges Mal gibt) privatisiert, wurden auf die grüne Wiese Supermärkte gebaut und wurde durch den intensiven Maisanbau der Boden für Jahre unfruchtbar – nachhaltig!
Zum Abschluss noch ein Brecht Zitat aus dem Jahre 1952 – wie aktuell!
„Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungskraft für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die weltweiten Schrecken der Vierzigerjahre scheinen vergessen. Der Regen von gestern macht uns nicht nass, sagen viele. Diese Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben, ihr äußerster Grad ist der Tod. Allzu viele kommen uns schon heute vor wie Tote, wie Leute, die schon hinter sich haben, was sie vor sich haben, so wenig tun sie dagegen. Lasst uns die Warnungen erneuern, und wenn Sie schon wie Asche in unserem Munde sind! Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die vorangegangenen wie armselige Versuche sind. Sie werden kommen ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden.“
Gisela Unglaube, Frankfurt an der Oder



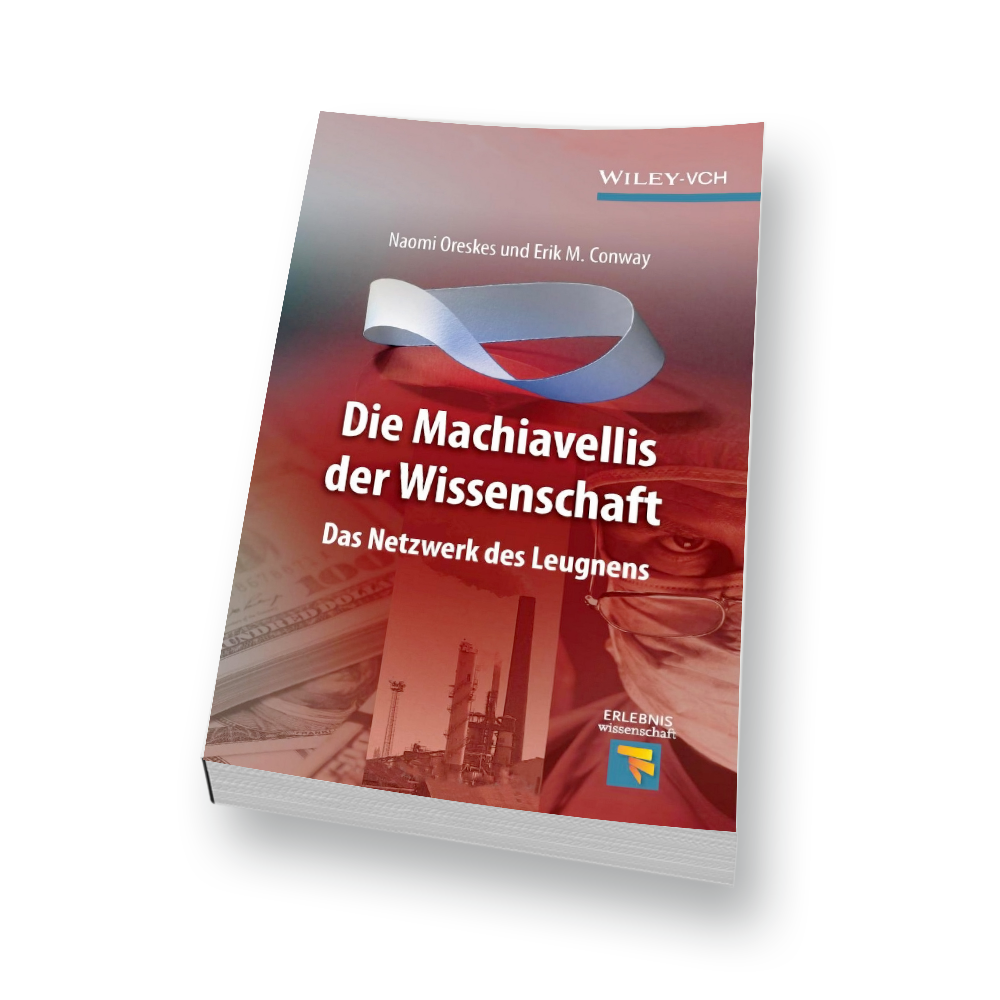

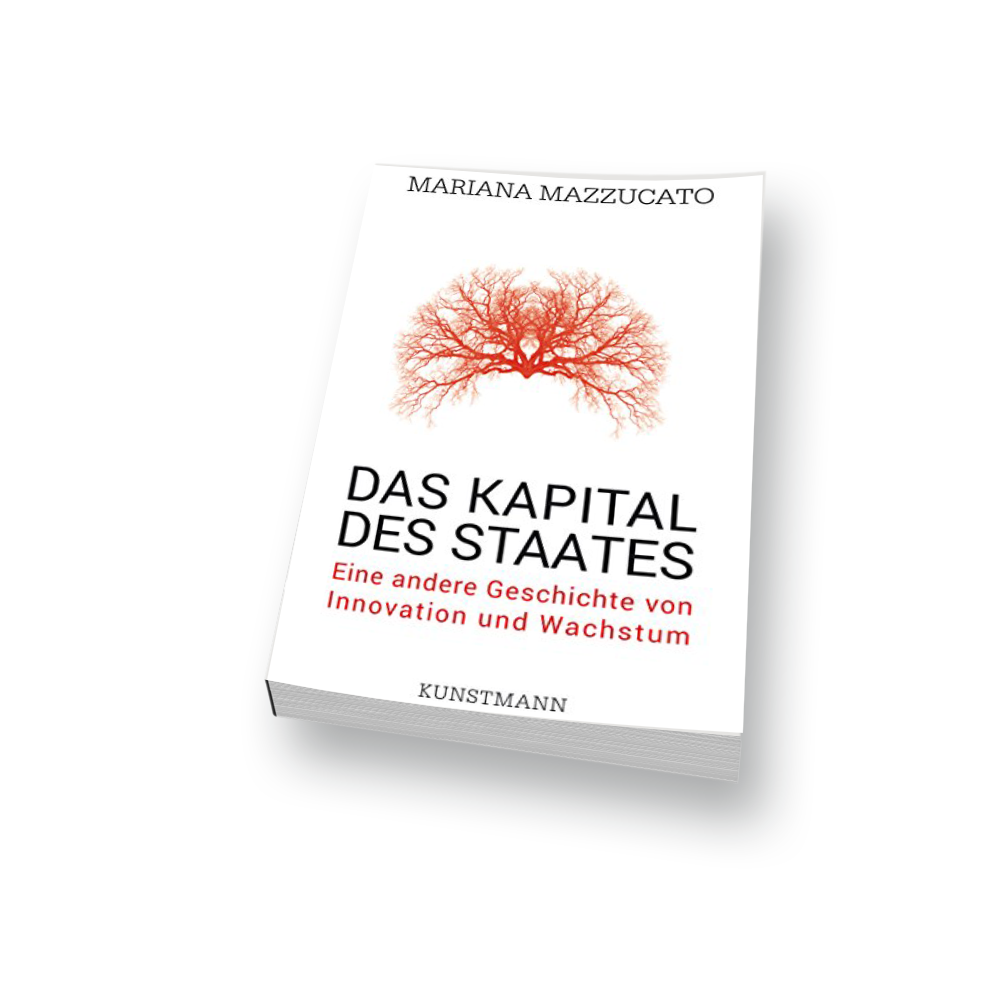



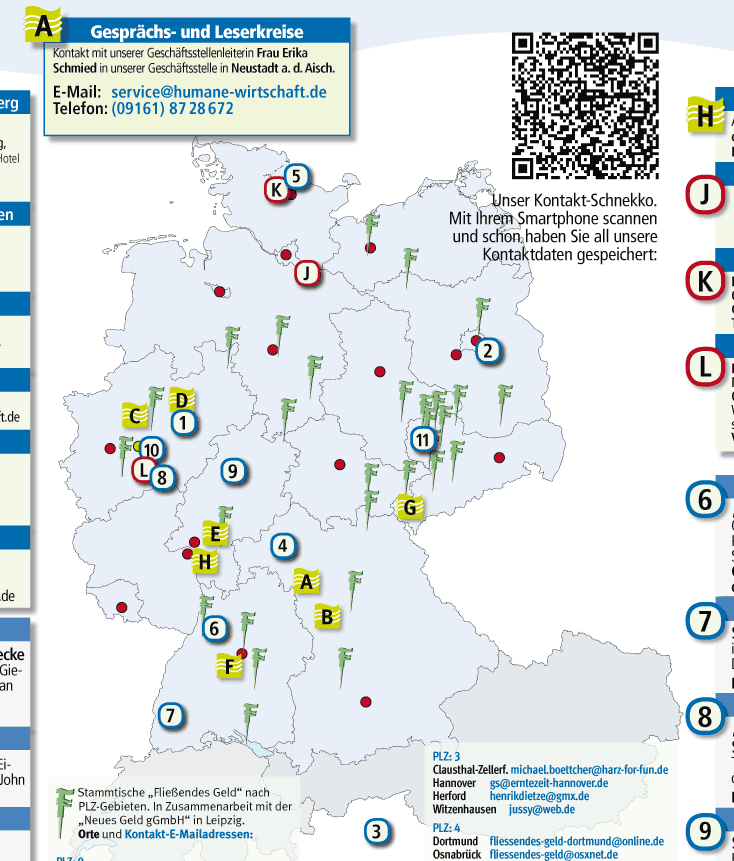


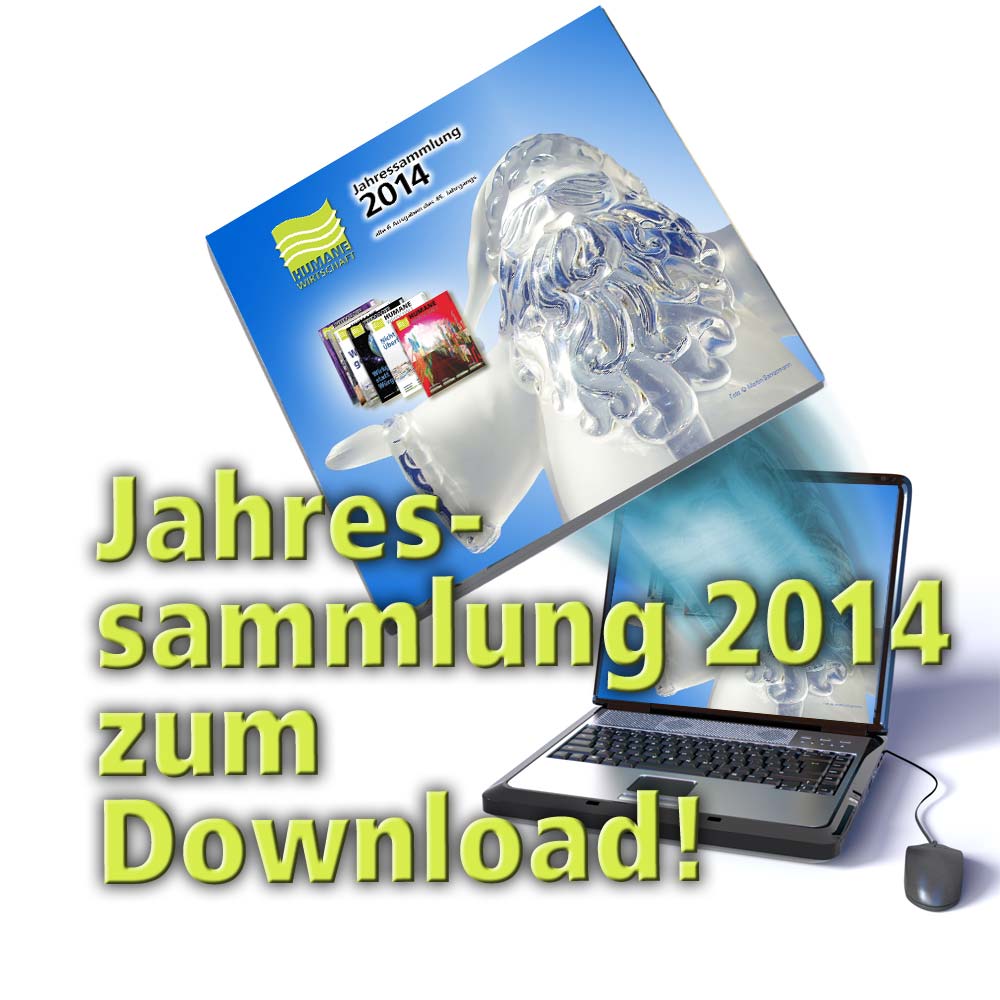






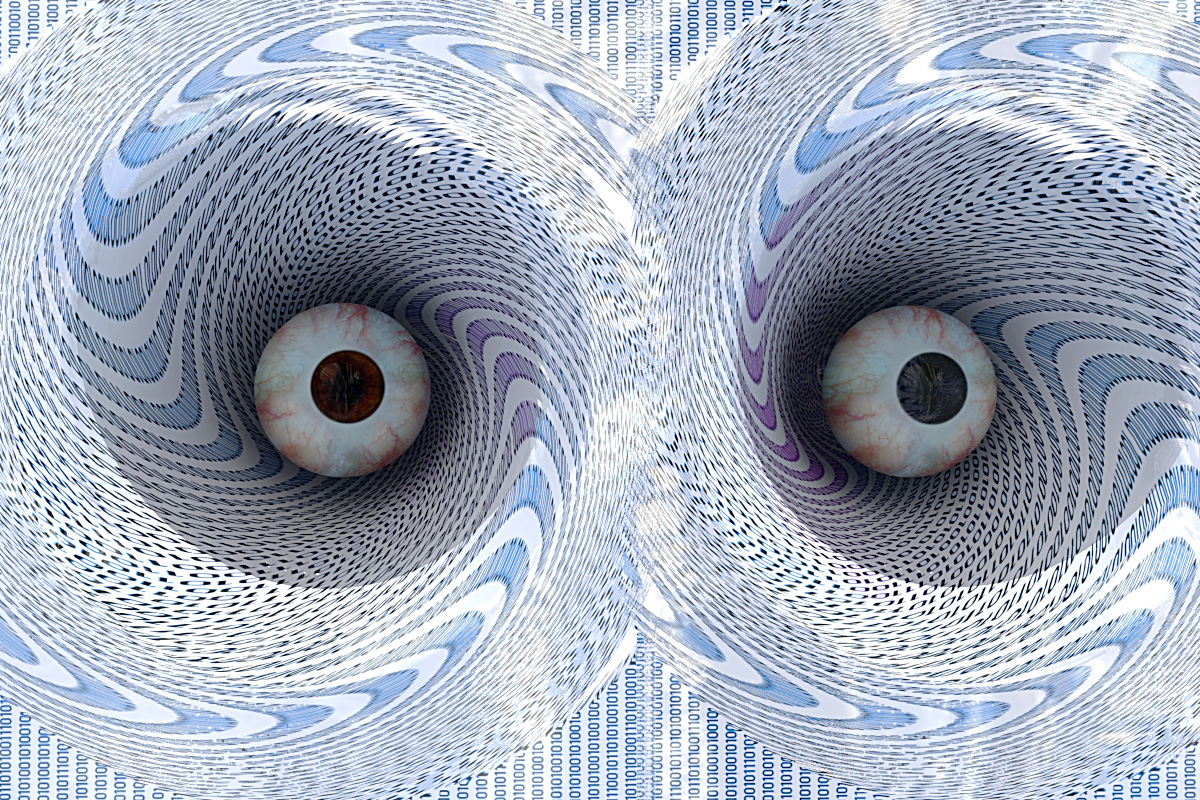

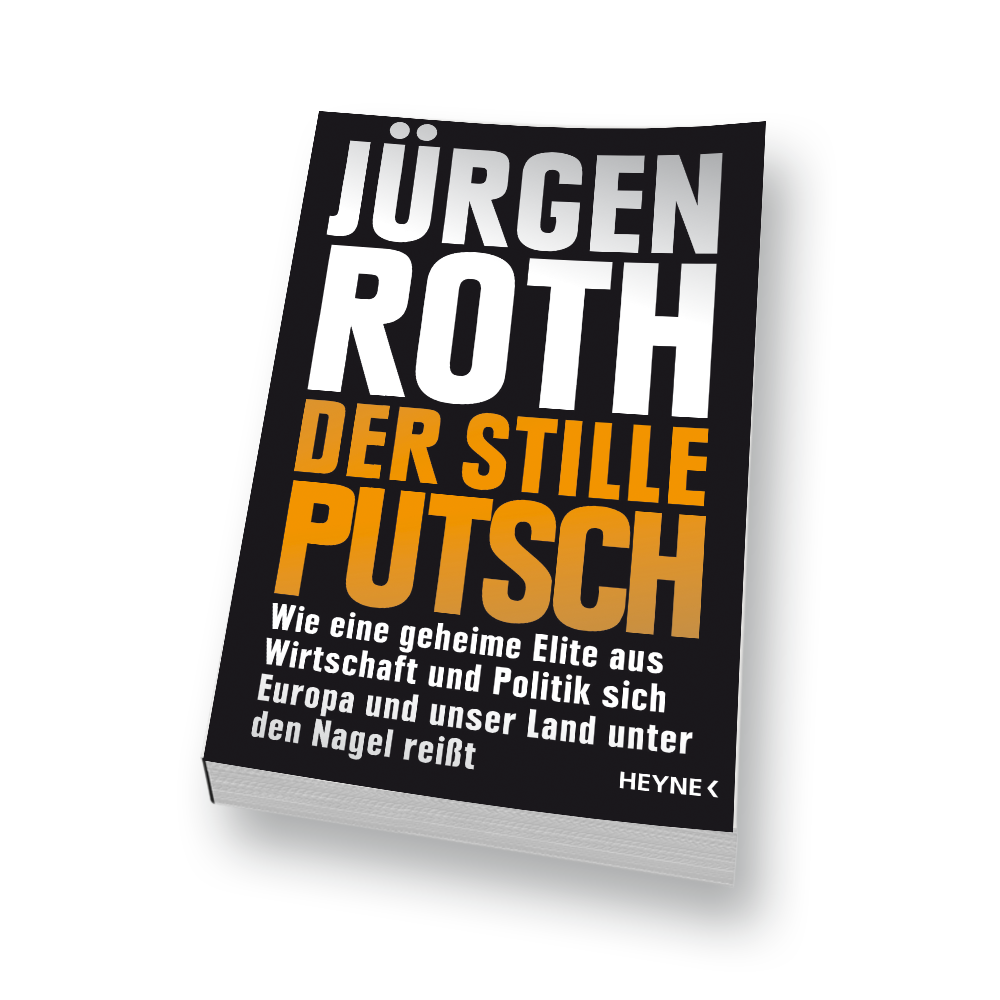
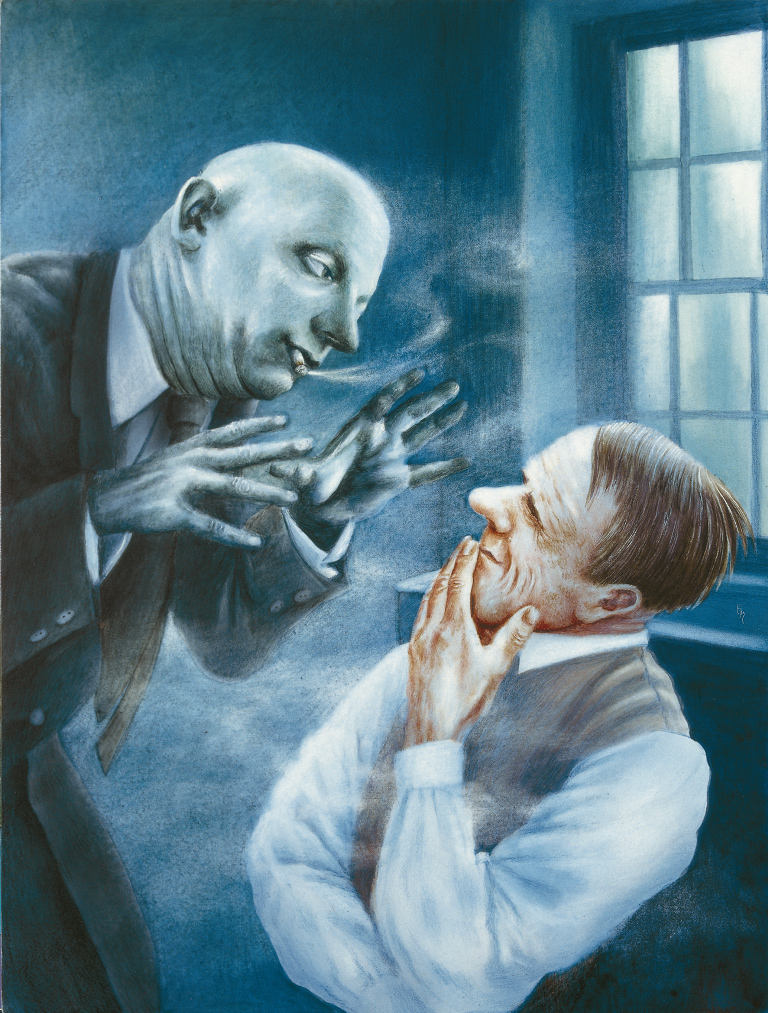

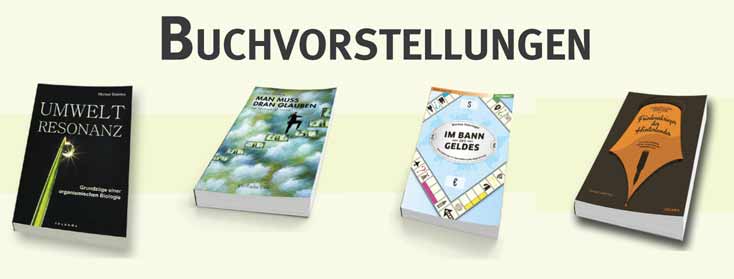
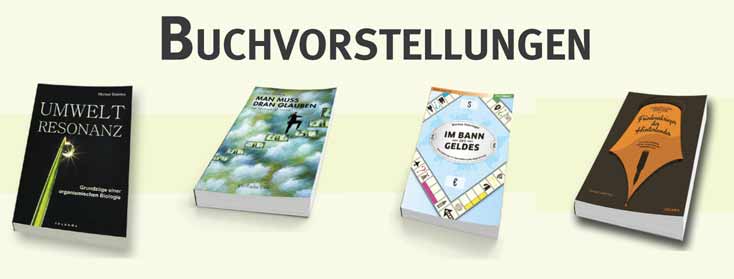

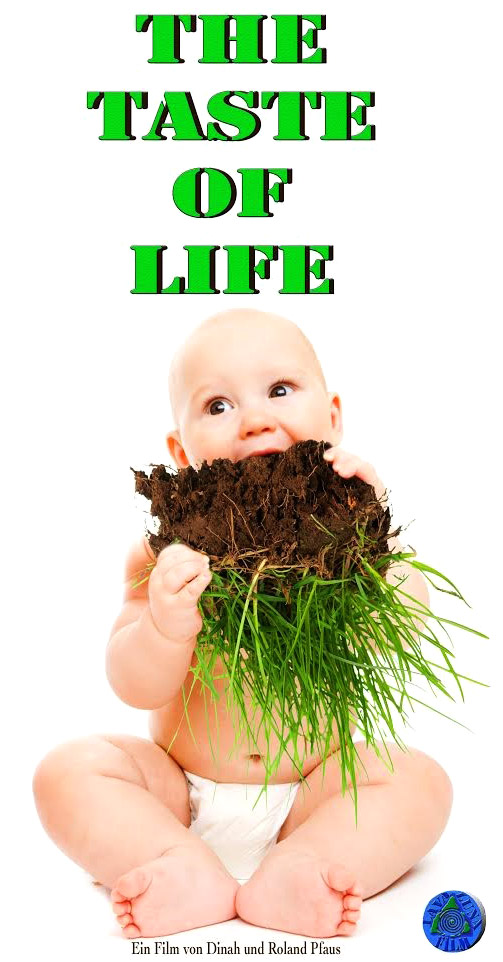
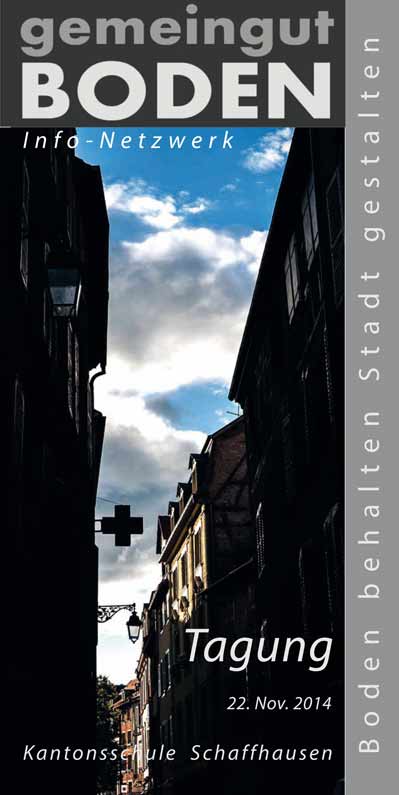
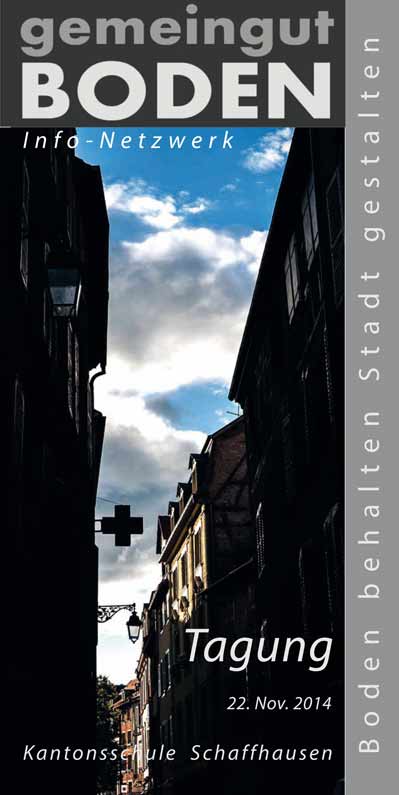 Am Samstag, 22. November, widmet sich eine öffentliche Tagung an der Kantonsschule Schaffhausen unter dem Titel „Boden behalten, Stadt gestalten“ den Fragen rund ums Baurecht. Klaus Hubmann, Mit-Initiator der neuen Basler Bodeninitiative, orientiert über deren Stand. Thomas Schlepfer vom Finanzdepartement der Stadt Zürich erläutert die Wohnbauförderung der Stadt mithilfe von Baurechtsverträgen. Uwe Zahn schildert die Bemühungen der Bieler Wohnbaugenossenschaften um neue Baurechtsverträge mit der Stadt. In einem Kurzreferat und in einem Podiumsgespräch wird die Bodenpolitik der Stadt Schaffhausen diskutiert. Workshops bieten Gelegenheit, die Referate zu vertiefen und die Diskussion unter den Teilnehmern anzuregen. Das Künstlerduo Sago aus Essen (D) bereichert die Tagung mit ihren Beiträgen. Veranstalter der Tagung ist das Info- Netzwerk „Gemeingut Boden“, ein vorläufig loser Zusammenschluss von Öffentliche Tagung zum Baurecht sechs Schweizer Stiftungen, die in unterschiedlicher Form mit dem Baurecht und dem Boden beschäftigt sind. Informationen und Anmeldung:
Am Samstag, 22. November, widmet sich eine öffentliche Tagung an der Kantonsschule Schaffhausen unter dem Titel „Boden behalten, Stadt gestalten“ den Fragen rund ums Baurecht. Klaus Hubmann, Mit-Initiator der neuen Basler Bodeninitiative, orientiert über deren Stand. Thomas Schlepfer vom Finanzdepartement der Stadt Zürich erläutert die Wohnbauförderung der Stadt mithilfe von Baurechtsverträgen. Uwe Zahn schildert die Bemühungen der Bieler Wohnbaugenossenschaften um neue Baurechtsverträge mit der Stadt. In einem Kurzreferat und in einem Podiumsgespräch wird die Bodenpolitik der Stadt Schaffhausen diskutiert. Workshops bieten Gelegenheit, die Referate zu vertiefen und die Diskussion unter den Teilnehmern anzuregen. Das Künstlerduo Sago aus Essen (D) bereichert die Tagung mit ihren Beiträgen. Veranstalter der Tagung ist das Info- Netzwerk „Gemeingut Boden“, ein vorläufig loser Zusammenschluss von Öffentliche Tagung zum Baurecht sechs Schweizer Stiftungen, die in unterschiedlicher Form mit dem Baurecht und dem Boden beschäftigt sind. Informationen und Anmeldung:

